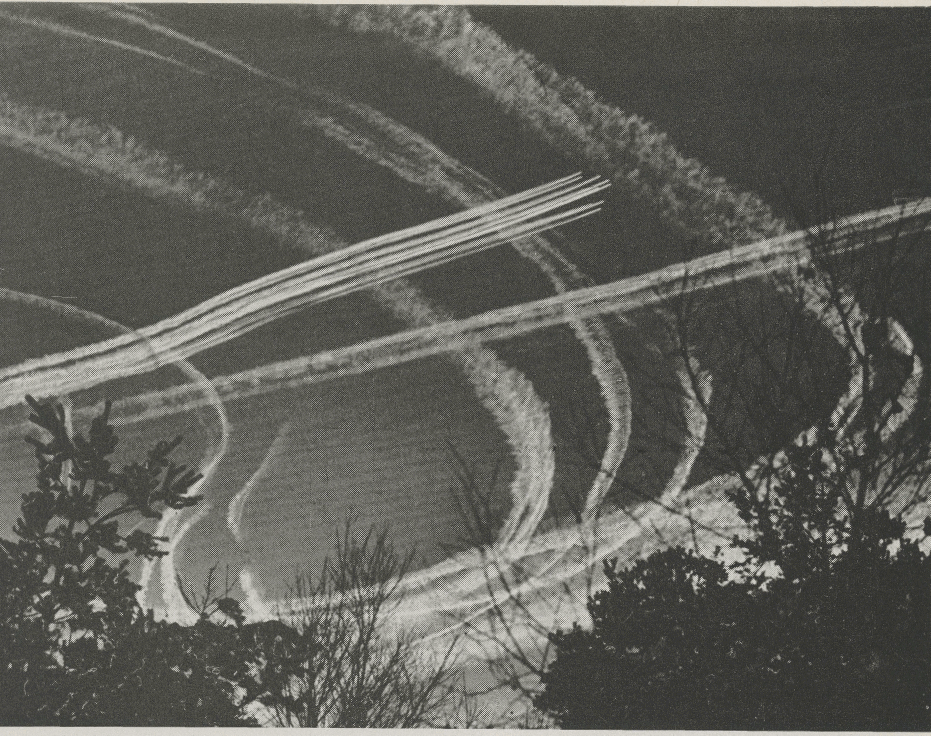
Vor 3O Jahren:
Ende der Kriegsschrecken in der Vulkaneifel
Nico Sastges
Vorweg genommen:
Am 6.17. März 1975 sind 30 Jahre verflossen, seit Truppen der USA weite Landstriche des Kreises Daun besetzten. Zwar war mit dem Schweigen der Geschütze nicht alle Kriegsnot überwunden, aber es wurde ein Schlußstrich gezogen unter die Schrekken der Bombennächte. Für die Überlebenden in der Vulkaneifel werden der 6.17. März 1945 zeitlebens denkwürdige Tage bleiben. Das Grauen ebbte ab doch die Wehklage blieb.
Der Gedanke der Redaktion, Kriegsgeschehen und Wiederaufbau in diesem Jahrbuch zusammenzufassen, erwies sich bei der Durchforstung des Quellenmaterials als zu weit gespannt, zumal dem Kriegsende zunächst drei Jahre der Notzeit folgten, in denen die Trümmerbeseitigung alle Kräfte in Anspruch nahm und nur Provisorien über die Hindernisse der Zerstörung und Besatzung hinweghalfen. Daß für die Geschichtsschreibung im Kreise Daun ein Bündel authentischer Daten zur Hand liegt, ist ein Verdienst von Kreisamtsrat i. R. Hans Schneider (Daun), der in dieser Zeit als Büroleiter der Kreisverwaltung das Kriegs- und Nachkriegsgeschehen aus der Nähe erlebte. Dennoch kann hier nicht das gesamte Kriegsgeschehen im heimatlichen Raum erfaßt werden. So mögen den Wissenden einige Dokumentationen ausreichen, die dennoch der Nachwelt, selbst als Stückwerk, ein Bild jener trostlosen Zeit vermitteln, die der heutigen Wohlstandsgesellschaft vorausging.
Die Zahl derer, die den Krieg erlebten, wird Jahr um Jahr geringer und der Wiederaufbau hat die Spuren des Krieges verwischt. Wer erinnert sich noch der Unruhe, die 1938 mit den Einquartierungen für den Westwallbau in die heimischen Städtchen und Dörfer getragen wurde? Wo ist das Datum festgehalten, an dem der erste Bombenblindgänger 1943 die Erde im Liesertal aufwühlte und einen Tag später während des Gottesdienstes mit ohrenbetäubender Detonation den Menschen in der Kreisstadt die Nähe des Kriegsfeldes zum Bewußtsein brachte?
Schon zu Beginn des Krieges wuchs die Last für die Bevölkerung. Starke Truppenkontingente verstärkten die Einquartierungen, so daß in den ersten Kriegsmonaten des Kanonendonners in Polen die Zahl der Soldaten, Westwallarbeiter und Arbeitsdienstmänner im Kreis Daun etwa der damaligen Bevölkerungszahl entsprach. Man stelle sich einmal vor, daß ab morgen Haus für Haus die Zahl der Familienangehörigen sich verdoppelt, um zu begreifen, welche Unannehmlichkeiten mit einer solchen Invasion verbunden sind. Denn diese riß in fünf Kriegsjahren nicht ab, sondern nahm zum Kriegsende unerträgliche Formen an. Das waren äußere Begleiterscheinungen des Krieges, dessen Kern, Tod und Vernichtung, Zerstörung und Drangsal, der Darstellung in den folgenden Geschichtsblättern vorbehalten sei.
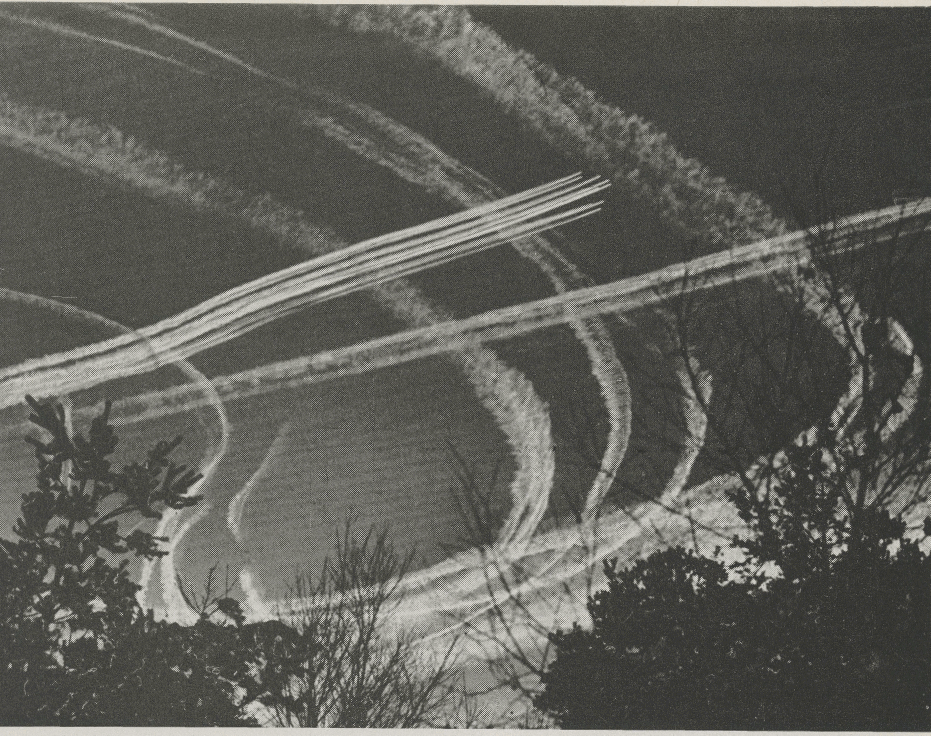
Feindlicher Bomberverband 1944 über der Eifel
Kreisstadt Daun in Not und Drangsal
Gebündelte Kondensstreifen der gegen Osten steuernden Bomberverbände gehörten zu Beginn des Jahres 1944 zum Alltagsbild am Horizont über der Vulkaneifel. Doch plötzlich, am 19. Juli, änderte am Vormittag ein Verband von 15 Bombern seine Richtung und näherte sich von Süden her der Stadt.
Hoch über dem Wehrbüsch zischte ein Magnesiumblitz aus der Führungsmaschine. Das Angriffssignal. Beobachter erstarrten vor Schreck. In Häusern und Betrieben überraschte die Menschen Sekunden später das Rauschen der Bombenabwürfe ... und schon war es zur Flucht zu spät Detonationen, ohrenbetäubendes Krachen und vielzähliges Echo steigerten sich zum Furioso. Das Zentrum der Stadt hüllte sich in eine dichte Staubwolke. Undurchsichtiger Rauch und Qualm behinderten die Sicht. Inmitten der wie ein Atompilz aufsteigenden und sich ausbreitenden Wolke brachen die Gebäude im Ortskern wie Kartenhäuser zusammen. Als sich der Vorhang lichtete, züngelten ungezählte Flammen brennender Häuser gen Himmel. Aus den Trümmerbergen gellten die Hilferufe der Verletzten. Meterhohe Trümmer versperrten den Weg zur Hilfeleistung. Nachstürzende Mauern, Fensterrahmen, Schornsteine, Dachfirste und geborstene Giebel vervollständigten die Katastrophe.
Dem Ort des Grauens eilten aus allen Himmelsrichtungen die Überlebenden zu. Aus den Nachbardörfern strömten Helfer in Scharen herbei, um gemeinsam mit Soldaten ihre Kraft in den Dienst der Rettung von Verwundeten zu stellen und Tote zu bergen. Doch das Ausmaß des Trümmerfeldes machte es erforderlich, die technische Nothilfe aus den bis dahin noch verschonten Orten Gerolstein, Prüm sowie Soldaten aus Wittlich einzusetzen. Herzzerreißende Szenen begleiteten die Bergungsarbeiten. Bombentrichter blockierten die Straßen zum Krankenhaus, So wurden die Toten im nördlichen Teil des zerstörten Ortskerns in den Garagen des Hotels Schramm aufgebahrt, die Verwundeten Im Hotel Gandner-Heines untergebracht. Im Süden wurde das Hotel Groß gegenüber dem Krankenhaus zur Notaufnahme offen gehalten. Ärzte und Helferinnen des DRK wirkten rund um die Uhr. Not und Drangsal erzwangen übermenschliche Anstrengungen. Krankenwagen des DRK brachten zahlreiche Verletzte nach erster Hilfe zum Krankenhaus Gerolstein. Die Bilanz des Grauens beim ersten Großangriff auf die Kreisstadt, bei dem 130 Bomben abgeworfen wurden, vertiefte die Kriegsschrecken. 30 Frauen, 27 Kinder und acht Männer wurden aus den Trümmern tot geborgen. 209 Personen wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt. Zwei Tage später war der Eischeider Hof Ziel eines Bombenabwurfs, bei dem Gutsbesitzer Fuchs auf dem Acker aus dem Diesseits abberufen wurde. Danach hielten nächtliche Aufklärungsflugzeuge die Bevölkerung in Angst. Ihre grellen Magnesiumschirme erleuchteten die Landschaft taghell und ließen niemanden zur Ruhe kommen. Am 22. Dezember folgte ein Luftangriff auf einen Truppentransport in der Nähe des Bahnhofs. Sechs Soldaten tot, 25 verwundet. Im Zuge der Vorbereitungen zur Rundstedt-Offensive blieben Eisenbahn- und Straßenknotenpunkte im Dauerfeuer der alliierten Verbände. Drei Bomben, die vermutlich den Dauner Viadukt zerstören sollten, fielen am 23. Dezember in die alte Darscheider Straße und begruben neun Einwohner und vier Soldaten unter Trümmern. Das war gegen 5 Uhr früh. Um 14 Uhr forderte der Luftkrieg im unteren Stadtteil weitere zwölf Todesopfer. Eine Stunde später verschütteten Bombenabwürfe mehrerer Flugzeuge eine Mutter mit zwei Kindern unter den Trümmern des brennenden Hauses im Stadtteil in der Schweiz.
Not und Drangsal waren in jenen Tagen übergroß. Gegen Luftangriffe war die Bevölkerung machtlos. Das Elend wuchs und machte alle Helfer kopflos. An diesem 23. Dezember wurde auch Drogist Hans Hoffmann, der sich um die Linderung der Kriegsnot besondere Verdienste erworben hatte, Opfer des Bombenkrieges. So steigerte sich auch die Gereiztheit der Menschen. Und nur diese erklärt, daß durch fremde OT-Leute drei in der Nähe Dauns notgelandeten Feind-Piloten gleiches Todes-Schicksal widerfuhr. Doch trotz aller Not und Wirren, die einheimische Bevölkerung verurteilte diese Racheakte

Hotel Hommes nach dem Luftangriff
Trostlose Jahreswende 44/45
Berge von Trümmern und Mauerreste ausgebrannter Häuser. Trostlosigkeit überkam die Bewohner, die zur Abendstunde aus ihren Verstecken aus den nahen Waldungen zum Ort des Grauens zurückkehrten. Doch das Verweilen zwischen rauchenden Trümmern währte nicht lange. Als tags darauf der Heilig-Abend 1944 anbrach, sank die letzte Hoffnung auf ein Pardon der militärischen Stäbe dahin. In den Mittagsstunden wühlten weitere 80 schwere Bomben den Boden am Kampbüchel, entlang der Gartenstraße und am Arensberg auf. Weitere Häuser brachen zusammen und begruben ihre Bewohner: 16 Kinder, 12 Frauen, drei Männer und vier Soldaten. Allein in einem stark abgestützten Schutzkeller wurden 23 Menschenleben ausgelöscht.
Wohin noch fliehen bei Frost und Kälte? Man suchte Unterschlupf in den schon menschenüberfüllten Nachbardörfern, baute hausnahe Stollen oder grub Schutzwinkel in Berghänge. Die Kreisverwaltung siedelte zur Aufrechterhaltung lebensnotwendiger Versorgung nach Niederstadtfeld über. Bomben töteten am 29, Dezember einen Soldaten und verletzten drei Zivilpersonen. Schauer über das Unheil und die Machtlosigkeit gegenüber roher Gewalt der Kriegsmaschinerie begleiteten die Menschen zum Jahreswechsel. Aber schon am 2. Januar 1945 setzten drei Bombenangriffe das Zerstörungswerk in der Kreisstadt fort. Vier Frauen, vier Männer, ein Kind und zwei Soldaten kamen ums Leben, fünf Personen wurden verwundet. An jenem Tag sank auch die tausendjährige Dauner Pfarrkirche St. Nikolaus in Trümmer. Ein Volltlreffer verschonte nur den Turm. Eine mit der Reinigung des Kirchenraumes betraute Frau wurde tödlich verletzt.

Das zerstörte Haus Schwoll in der Lindenstraße, links Haus Schneider
Am 4. Januar wurde Daun angeblich zur Lazarettstadt erklärt. Es bedurfte der Erklärung nicht. Wo immer größere Säle erhalten geblieben waren, betreuten Ärzte, Sanitäter, DRK-Helfer und viele Frauen und Mütter Verwundete. Denn auch die Front rückte näher. Damit begannen die Fliegerangriffe mit Bordwaffen. Zwei Angriffe am 29. Januar hoben den Evakuierungsraum der Lazarettstadt auf. 30 Bomben fielen am 10. Februar zwischen Kampbüchel und Gartenstraße. Der Tod erntete weiter. Dann rollte der Front-Nachschub zwischen aufgeschichteten Trümmerbergen hindurch. Der Bordwaffenkampf aus der Luft verstärkte sich. Am 3. März erfolgte der 23. und letzte Luftangriff auf Daun. Vier Frauen, ein Kind, ein Mann und sieben Soldaten hauchten ihr Leben aus. Schlossermeister Matthias Keller schloß die Liste der Ziviltoten. Die Zahl der Verwundeten ließ sich kaum noch erfassen. Der Erdkampf schien den völligen Untergang der Stadt einzuleiten. Jagdbomber ließen tagsüber jeglichen Verkehr und auch die Lebensmittelversorgung erstarren. Am 5. März harkte die alliierte Artillerie die Dörfer und Wälder im Hinterbüsch und im Tal der Kleinen Kyll ab. Deutsche Truppen wichen dem übermächtigen Druck. Einige Störkommandos verschanzten sich in Dörfern und Wäldern, sprengten Brücken und rundeten damit das Bild sinnloser Zerstörungen ab.
Die beiden unteren Bilder zeigen die Zerstörungen im Stadtzentrum von Daun

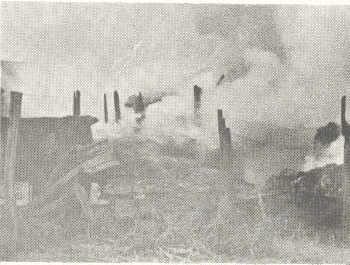
Maschinengewehrsalven eines Ami-Panzerspähwagens von der Pützborner Höhe in den nördlichen Teil Dauns kündeten am 6. März gegen 9 Uhr den Anmarsch der US-Truppen an. Wenige Minuten später überrollten 200 Ami-Panzer die in völliger Verwirrung der deutschen Truppenführung errichteten Panzersperren. Pausenlos bahnten nachfolgende riesige Räumgeräte der Truppe den Weg durch die von Geräten, Schutt und Schnee verschlammten Straßen. Die Besatzung des ersten amerikanischen Panzers entfernte die Sprengladung am Eisenbahnviadukt der Bahnlinie DaunWittlich. Ein Dauner Ehepaar, das am Mühlenberg unterhalb des Weinfelder Tunnels ein Notlager bezogen hatte, vermochte kurz vorher den Zug des aus Schalkenmehren anrollenden Sprengkommandos aufzuhalten und den mit der Sprengung des Viadukts beauftragten deutschen Offizier von der Sinnlosigkeit des ihm erteilten Befehls zu überzeugen. So war der Viadukt gerettet ... und der in den Tunnel zurückgedrückte und dort stehengebliebene Zug gab in einigen Waggons Lebensmittel frei, nach denen sich die Bevölkerung in Daun, Schalkenmehren und Mehren sehnte. Der Gefechtslärm verebbte, doch die Not blieb getreuer Begleiter der Bevölkerung. Der Kampf ums Überleben nahm ohne Detonationen neue Formen an.
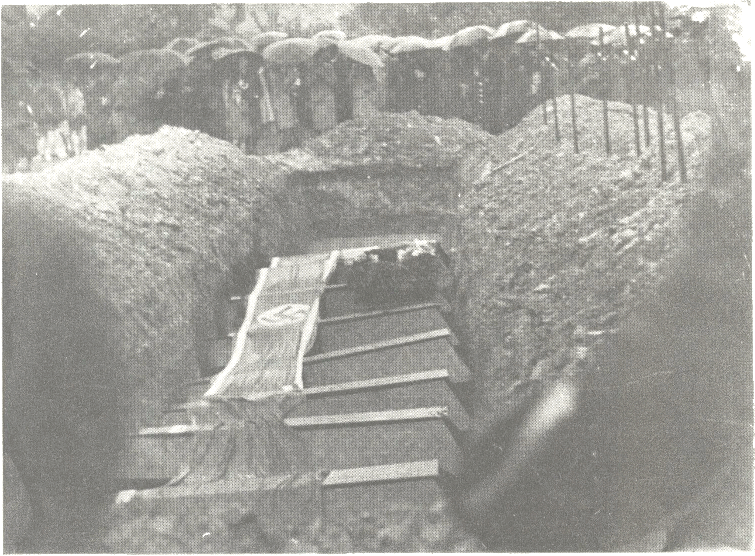
Beisetzung der Opfer auf dem Friedhof in Daun
Zerstörung Gerolsteins aus der Nähe erlebt
Dechant i. R. A. Molter, Buweiler/Saar, damals Pastor in Gerolstein, berichtet nachstehend über die Kriegsereignisse in Gerolstein. Gerne komme ich der Bitte der Kreisverwaltung von Daun nach, aus meinen Aufzeichnungen und Erinnerungen über das schreckliche Ende 1944/45 und über die Zeit zwischen Zerstörung und Wiederaufbau aus dem Gerolsteiner Raum zu berichten.
Nach der Invasion im Juni 1944 zeigte sich das Ende des Krieges und des „Dritten Reiches" an. Versprengte und zerschlagene Verbände des Heeres fluteten fast in völliger Auflösung durch die Stadt dem Rheine zu. Zu Dienstleistungen verpflichtete Luxemburger setzten sich in Richtung Heimat ab. Der Ortsgruppenleiter, Schulrat Wesendahl, verließ Gerolstein. Rektor Michels trat an seine Stelle. Er fand am ersten Weihnachtsfeiertag den Tod bei einer Weihnachtsfeier in der St.-Josef-Schule.
Da die Amerikaner nicht nachdrängten, sondern am Westwall stehen blieben, kam ein kurzer Stillstand der Kampfhandlungen. Inzwischen wurde der totale Krieg erklärt. Die Volksarmee wurde gebildet. Es wurden die letzten Männer in Stadt und Land sowie die Jugend zum Wehrdienst einberufen. Stellungen wurden aufgebaut von Arbeitskräften der OT, der Hitlerjugend und der dienstunfähigen Männer von Saar und Eifel. Ein Spionagedienst mit zwei Abteilungen, die voneinander nichts wußten, wurde geschaffen. Die beiden verantwortlichen Leiter machten mich zum Mitwisser ihres Auftrages. Ihre Absicht war leicht zu erkennen.
Am 21. September 1944 fand der erste Großangriff auf Gerolstein statt. Die Bombenteppiche gingen auf Leutersfeld und dem Bahnhof nieder. Einige Fremde, die zufällig in der Stadt waren, kamen um. Die Pfarrkinder wurden von der Pfarrgeistlichkeit gebeten, sich Unterkünfte im Walde und in den Felsen zu suchen, da keine allgemeinen Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung getroffen waren. Viele Einwohner verließen auch die Stadt, um auf den umliegenden Dörfern oder auch rechtsrheinisch Schutz zu suchen. Etwa 800 Bürger blieben noch in der Stadt zurück. Am 2. Oktober wurden Bomben auf den Bahnhof abgeworfen. Keine Toten waren zu beklagen. Am Abend desselben Tages konnte man den Feuerschein der brennenden Stadt Aachen deutlich sehen. Am 20. Oktober Bombenabwurf auf Sarresdorf; ein Toter (Pole) und zwei schwer verletzte Pfarrkinder waren die Opfer.

Bischof Dr. Rudolf Bornewasser (Trier) besuchte 1945 die Pfarrei Gerolstein, r. Pastor Molter
Am Allerseelentag gingen wir abends noch zum Friedhof. Schon war der Kanonendonner von der Front zu hören. Großer Schrekken wurde den Menschen durch die V 1 eingejagt. Mit unheimlichem Getöse kamen diese Geschosse aus südöstlicher Richtung und gerieten beim Überfliegen des Tales oft in große Schwankungen. Einmal drehte sich eine, kam zurück und schlug im Gebiet der Dietzenley ein. Auch an der Hustenley ging eine nieder. Am 5. 'November schlug zwischen 7 und 8 Uhr eine in Gees ein, forderte 13 Menschenleben und richtete großen Schaden im Dorf an.
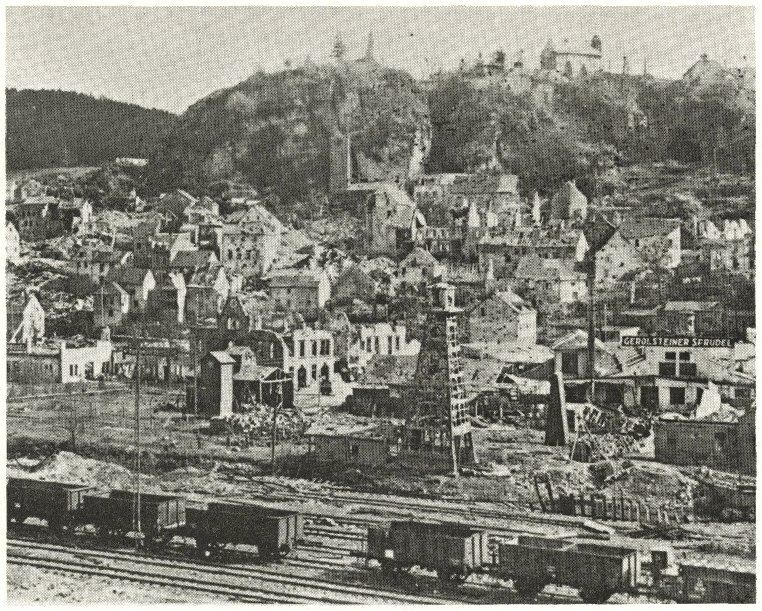
Zerstörtes Gerolstein
Der Krieg wurde immer ernster und gefährlicher für die Stadt. Es bereitete sich die Rundstedt-Offensive vor. Unaufhörlich ging der Strom der Volksarmee zur Westfront. Sie war schlecht bewaffnet und schlecht versorgt. Viele Fahrzeuge blieben am Straßenrand liegen. Das Wetter war trüb und bot ihnen Schutz vor Fliegerangriffen. Die Sinnlosigkeit dieser Offensive war jedem denkenden Menschen einsichtig. Doch gab es noch viele, die durch sie Hoffnung auf den Sieg setzten. Sie waren der Meinung, daß der Führer den Feind so weit ins Land hatte kommen lassen, um die Anwendung der Wunderwaffen zu rechtfertigen.
Am 16. Dezember, morgens um 5 Uhr, war in der Stadt der unaufhörliche Kanonendonner von der Front zu hören. Die Rundstedt-Offensive hatte begonnen. Schnell wurde die Volksschule, die schon seit Ende Juni außer Betrieb war, der Kindergarten, die Hotels zur Linde und zur Post in Lazarette umgewandelt. Viele Verwundete wurden eingeliefert. Bald waren das Krankenhaus und die Notlazarette über und über belegt. Die Schwerverwundeten wurden zuerst versorgt, Tag und Nacht wurde in zwei Abteilungen im Krankenhaus und in der Schule operiert. Was transportfähig war, wurde weitergeleitet. So kam der vierte Adventsonntag, der 24. Dezember, der Heilige Abend. In den frühen Mittagsstunden ging ein großer feindlicher Angriff auf Gerolstein nieder. Es regnete Spreng- und Brandbomben. Getroffen wurden unter anderem die St.-Josef-Schule und der Kindergarten. Viele verwundete Soldaten fanden den Tod, ebenfalls 26 Pfarrkinder. Bis spät in die Nacht hinein dauerten die Bergungsarbeiten, die immer wieder von Tieffliegern, die wahllos in die Stadt hineinschossen, gestört wurden. Brände loderten an verschiedenen Stellen der Stadt auf. Am 21. September war die Apotheke Winter hart angeschlagen worden. Man richtete eine neue in der St.-Anna-Schule ein. Sie wurde bei diesem Angriff getroffen und ging in Brand auf. Im Keller befanden sich das Ehepaar Winter, einige Soldaten und andere Einwohner. Sie kamen alle ums Leben. Man versuchte, den Brand zu löschen. Die Feuerwehr tat, was in ihren Kräften stand. Doch zur Front fahrende Panzer zerschnitten die Schläuche, in denen man das Wasser aus der Kyll heraufpumpte. Das war das Ende des vollen Einsatzes der Feuerwehr und auch des Roten Kreuzes. In der Heiligen Nacht wurden in der Pfarrkirche unter dem Schein der noch lodernden Brände die Metten gehalten. Am Tage vorher war die Lichtversorgung, die seit dem 21. September ausgefallen war- wiederhergestellt worden. Die Freude darüber war von kurzer Dauer. Am 24. 12. fiel sie wieder aus. Mit der Wasserversorgung war esebenso. Am Abend schöpfte man das Wasser in der Unteren Marktstraße an einem offenen Brunnen und in der Gerolstraße am Wasserwerk.
Am Weihnachtsfest selbst fielen schon in der Mittagsstunde Bomben. Unter den Trümmern des Hauses Eifel wurden 13 Tote begraben. Mit viel Mühe gelang es am späten Abend, Fräulein Lehrerin Eis zu bergen, die genau ein Jahr später an den Folgen dieses Schreckens starb. Der nächste Großangriff folgte am 27. Dezember. Die Bomben gingen nieder über Sarresdorf und der Lindenstrasse. 8 Pfarrkinder wurden getötet, verbrannten teils in ihren zusammengeschossenen Häusern. Leithnings (doppelrumpfige Jagdbomber) vollendeten zwischendurch das Werk der Verwüstung, indem sie Einzelziele angriffen. Getroffen wurde auch an diesem Tage das protestantische Pfarrhaus und der Turm der Kirche. Unter dem Turm befand sich ein Keller, in dem Pfarrer Wiebel mit seiner Hausangestellten Schutz suchte. Die beiden blieben unversehrt. Auch das Schwesternheim wurde zerstört. Am Abend verließ Pfarrer Wiebel mit ein paar Habseligkeiten Gerolstein, vertraute mir seine Pfarrkinder an und ging nach Bewingen, wohin er vorher schon seine kranke Frau und seine Kinder gebracht hatte.
Am 29. Dezember folgte ein schwerer Angriff. Er ging nieder über der Oberen Markt-, Haupt- und Gerolstraße. Die Zahl der Toten unter den Bürgern mehrte sich. An Sylvester wurde die Bahnhofstraße getroffen. Am Neujahrstag wieder die Haupt- und Gerolstraße. Am Dienstag, dem 2. Januar wurde in einem Großangriff der ganze Ort mit Bomben belegt. Im Bahnhofsstollen wurden 54 Menschen verschüttet, die erst 30 Stunden später geborgen werden konnten. Bei der Bergung waren noch 6 am Leben, von denen aber 3 bald starben. Josef Weber aus Linssingen ist der einzig Überlebende dieser Katastrophe. Am Abend rötete sich über Gerolstein der Himmel. Überall tobten Brände. Allenthalben herrschte große Not. Pfarrer und Kapläne schafften Lebensmittel vom Lande herbei. Von Roth aus kam allabendlich eine Feldküche, die die Bewohner rechts der Kyll mit Suppe und Brot versorgte. Diese Aktion ging von Pfarrer Anton Lenz und seinen Pfarrkindern aus.
In der Folgezeit waren die Straßen der Stadt tagsüber menschenleer. Die Leute hielten sich in den Stollen, Bunkern und Wäldern auf. Des nachts gingen sie in ihre Häuser, soweit das noch möglich war. Die Büschkapelle war der große Zufluchtsort diesseits der Kyll. Bunker an Bunker reihte sich um dieses Heiligtum Mariens. Durch die Katastrophe in Stadtkyll, wo viele Schwestern umkamen, gewarnt, wurde den Schwestern aus dem Krankenhaus ebenfalls ein Bunker gebaut. Nur 3 durften tagsüber den notwendigen Dienst im Krankenhaus versehen. Jenseits der Kyll suchten die Menschen Schutz im Buchenloch, Jesdeppen und im Maschinenschuppen. Am 21. Januar wurde das Krankenhaus durch einen Jagdbomberangriff funktionsunfähig. Eine Mine fegte knapp über das Dach und explodierte in den Anlagen. Alle Fenster- und Türfüllungen wurden zertrümmert. Erhalten blieb die Inneneinrichtung des Op. In der Frühe des 22. Januar wurden die Kranken und Verwundeten nach Daun abtransportiert. In der Mittagsstunde des 22. Januar forderte ein ganz heimtückischer Angriff über Stadtmitte und Burg 12 Menschenleben. Bis spät in die Nacht dauerten die Bergungsarbeiten. Bei diesem Angriff wurde die Pfarrkirche getroffen. Das Seitenschiff bis zum Eingang hin wurde zerstört, ebenfalls alle Fenster und die Statue der Schmerzensmutter. Das Dach wurde an vielen Stellen durchlöchert. Nur die Sakristei konnte noch für den Gottesdienst benutzt werden. Auch in sie hinein regnete es. Es türmten sich die Schuttmassen in den Straßen. Amerikaner, die am Schwarzen Mann in Gefangenschaft gerieten, mußten aufräumen und Gräber für die Toten schaufeln. Bis zum Tode erschöpft, kamen sie bei ihrer Arbeit nur mühsam voran. Viele sanken vor Elend nieder. Sie wurden zum Forstamt gebracht, wo ein Lazarett notdürftig für sie eingerichtet war. Hier starben viele. Die Pfarrgeistlichkeit verschaffte sich Zugang zu diesem Lazarett und stand den Sterbenden bei. Kosaken waren die Wachtposten. Es waren gutmütige Menschen, die uns keine Schwierigkeiten machten. Verschleppte Polen, Männer, Frauen und Kinder und ein Straflager von politischen Gefangenen (französische Frauen und Mädchen) hatten ein ähnliches Schicksal. Unter Gefahr für die persönliche Freiheit wurden sie bei Dunkelheit und des nachts seelsorglich von uns betreut, bis sie kurz vor der Besetzung der Stadt rückgeführt wurden. Am 10. Februar war ein schweres Artilieriefeuer im Räume von Prüm zu hören. Am 25. Februar wurde Büdesheim beschossen, am Samstag, dem 3. März, Gerolstein. Am Mittag dieses Tages rückten die amerikanischen Panzer in breiter Front auf der Höhe von Weinsheim und Godelsheim vor. Die deutsche Front war in der Auflösung begriffen. In der ganzen Zeit der Offensive war kaum ein deutsches Flugzeug zu sehen. Dem Sturm auf Gerolstein am 6. 3. ging ein schweres Trommelfeuer voraus. Durch dieses wurde die amerikanische Infanterie, die von Lissingen und Bewingen, begleitet von Panzern, eindrang, gegen die Deutschen auf dem Auberg, der Munterley und der Stadt schützend abgedeckt. Deutsche Artillerie am Heidkopf und amerikanische Artillerie am Sandberg in Lissingen lieferten sich ein hartes Duell. Zu dieser Stunde befand ich mich bei den Leuten an der Büschkapelle. Es waren an Zahl etwa 350. Sie waren zwischen den zwei Fronten in einer bedrohlichen Lage. Mein Kaplan Schneiders war im Keller des Krankenhauses. Bis dorthin drangen die Amerikaner beim ersten Sturm vor. Vom Kaplan erfuhren sie von unserer Situation. Sie sagten ihm, daß wir in höchster Gefahr seien. Daraufhin machte er sich mit Schwester Brunhilde auf den Weg und brachte uns die Nachricht in den Wald: wir sollten sofort den Wald verlassen und zur Stadt kommen. Das aber war unmöglich bei dem schweren Artilleriefeuer. Ich entschloß mich, mit Kaplan Schneiders und der Schwester Brunhlide durch die Front zu den Amerikanern hinüberzugehen, um Schutz für die Zivilbevölkerung zu erbitten. Kaplan Kutten ließen wir bei den Leuten zurück und gingen in einem Abstand von etwa 10 Metern auf die amerikanische Linie zu. Wir wählten diesen Abstand, damit bei einem Einschlag einer Granate wenigstens einer von uns dorthin kommen sollte. Die Amerikaner waren zum zweiten Sturm angetreten und bis zur alten Siedlung vorgedrungen. So gelangten wir in ihre zweite Angriffswelle. Ganz vorn in der stürmenden Linie traf ich einen amerikanischen Feldgeistlichen. Ich wechselte ein paar Worte mit ihm und brachte meine Bitte vor. Er ging mit mir hinter ein Haus in Deckung, ging dann wieder nach vorn und schickte mir einen Offizier, der mich in den Befehlsstand des Kampfleiters führte, während die Schwester und der Kaplan in den Keller des Krankenhauses zurückkehrten. Der Befehlsstand befand sich im Kinosaal des Hotels zur Linde. Es dauerte ungefähr eine halbe Stunde, bis der Kampfleiter mich anhörte. An Hand einer Karte, die er vor sich liegen hatte, konnte ich ihm genau zeigen, wo sich die Zivilbevölkerung befand. Ich bat ihn, sie mit dem Artilleriefeuer zu verschonen. Er versprach es mir und ließ mich in den Keller des Krankenhauses abführen. Zurück durfte ich nicht. Er hielt sein Wort. Keine Granate schlug an der Büschkapelle ein. Auf der gegenüberliegenden Seite der Kyll standen sich zur selben Zeit in Sichtweite amerikanische und deutsche Infanterie in hartem Kampf gegenüber. Eine Hilfe für die Leute jenseits der Kyll war Dr. Luy, der Chefarzt des Krankenhauses. Er war der einzige Arzt, der in diesen schweren Tagen in der Stadt blieb. Gegen Abend war die ganze Stadt von den Amerikanern besetzt. Langsam bewegte sich die Front nach Dockweiler zu, Während ein anderer Angriff von Birresborn her über Michelbach, Gees nach Kirchweiler vorangetragen wurde. So wurde die Kyllstellung der Deutschen in diesem Raum aufgerollt. Es folgten nun harte Tage für die Zivilbevölkerung. Ausgiebig wurde geplündert. Die Kriegsgefangenen wurden in der Stadt zusammengeführt. Es waren dies vor allem Franzosen, die sich bei Bauern in den umliegenden Dörfern befanden. Sie wurden der Bevölkerung nicht zur Gefahr, wohl aber die arbeitsverpflichteten Ukrainer und Polen. Diese überfielen oft Bauernhöfe und schreckten auch nicht vor Bedrohung mit der Waffe zurück. Durch die schnelle Einrichtung der Militärregierung kam Rettung.
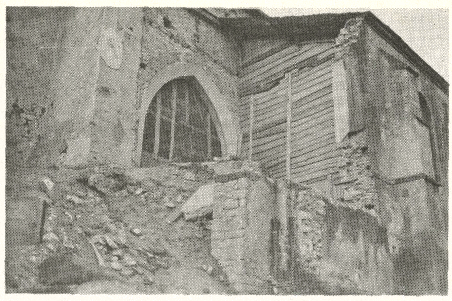
Auch die katholische Pfarrkirche Gerolstein wurde zerstört.
Zwei Tage nach dem Sturm auf Gerolstein wurde ich zur Militärregierung gerufen, die sich im Hansasprudel etabliert hatte. Ich sollte Männer nennen, die ihnen bei ihrer Verwaltung behilflich sein könnten, fachkundige Kräfte für das Gesundheitswesen, die Ernährung, die Wohnungsbeschaffung, die Aufräumungsarbeiten usw. Das geschah. Der Chef der Militärregierung war Captain Steiner. Durchweg war er wie auch seine Leute hilfsbereit und zeigte Verständnis für unsere Situation und Not.
Die Militärregierung der Amerikaner war erträglich. Etwas schwieriger wurde es, als die Franzosen kamen. Es folgten unangenehme Beschlagnahmungen von Wohnungen und Haushaltsgegenständen aller Art. Schlimm war auch die Dezimierung des Vieh- und Waldbestandes. Unerfreulich auch die sogenannte Entnazifizierung. Von der Besatzung angeordnet und von den Deutschen durchgeführt, hinterließ sie tiefe Wunden. Denunziantentum aus Rachsucht und Streben nach Macht und persönlichen Vorteilen war nicht selten. An der Spitze des Kreises stand der spätere Landrat Feldges. Er war ein Mann von Güte und großer Umsicht. Mit der Militärregierung wußte er gut umzugehen. Er entschärfte manche Härte bei der französischen Kreiskommandantur. Das war wichtig, da ja jede Selbstverwaltung vorerst ausgeschlossen war. Er fand in Gerolstein und in den umliegenden Dörfern Männer, die durchweg das Vertrauen des Volkes besaßen und in dem engen Aktionsraum, der ihnen unter der Überwachung durch die Kreiskommandantur zur Verfügung stand, langsam eine sich anbahnende deutsche Verwaltung vorbereiteten. Die Versorgung fing an, geordneter und besser zu werden. Der Bauernstand kam langsam zur Ruhe. Es zeigten sich auch Anfänge eines kulturellen Lebens. Vor allem wurde am Aufbau des Schulwesens begonnen. Man sah sich bald nach einem neuen Schulrat um. Es war Herr Robert Legrand aus Heyroth. In Gerolstein wurde am 8. 11. 1945 unter Leitung des Hauptlehrers August Schlömer mit dem Schulunterricht begonnen, zuerst im Hotel zur Linde, später dann im Ratskeller. Die Rektoratsschule und damit das jetzige Gymnasium wurde für die Stadt Gerolstein unter schweren Anfängen gerettet.

Die Ruinen des Rathauses Gerolstein
Die Kirche in dieser Zeit war sichtbar in der großen, oft heldenmütigen Sorge der Priester und der großen Liebe der Pfarrkinder untereinander. Die Seelsorge wurde von Pfarrer Alois Molter und seinen beiden Kaplänen Edmund Kutten und Lorenz Schneiders in Gerolstein und seinen 5 Filialen ausgeübt. Am 1. Mai 1944 griffen zum ersten Male Tiefflieger Gerolstein an. Von da ab löste ein Alarm den anderen ab. Jäger hielten den Raum fast unangefochten in Schach und sorgten für ständige Angst, Schrecken und Gefahr. Unter diesen Umständen war es nicht mehr zu verantworten, die Pfarrkinder von Gees zur Pfarrkirche kommen zu lassen. Es wurde deshalb ein Sonntagsgottesdienst in Gees eingeführt. Weiter wurde der Gottesdienst am frühen Morgen und bei Einbruch der Dunkelheit gehalten. Bis Weihnachten konnte er noch in der Pfarrkirche stattfinden. Später nur noch in der Sakristei. Sofort wurden Gottesdienste zusätzlich in Büscheich, im Jes-deppen und in der Büschkapelle und dem Buchenloch eingerichtet. Der Unterricht in den Schulen schloß mit dem Beginn der Sommerferien. Soweit wie möglich wurden die Kinder in den Felsenunterkünften, in den Waldbunkern und Filialorten erfaßt. In dieser großen Not und Gefahr schlössen sich Priester und Volk eng zusammen. Die Menschen kamen sich einander näher. Es bewährte sich die Hilfsbereitschaft aller, ja man kann sagen, sie steigerte sich mit der zunehmenden Not. Die sonst so verborgenen Kräfte christlichen Daseins kamen fast bei allen zum Vorschein. Es wurde viel gebetet. So wurde nicht nur die höchste Not überwunden, sondern es erblühte aus den Ruinen ein neues kirchliches Leben. Die Freiheit der Kirche legte sich wie ein großer Segen und tiefer Friede über alle. Die Pfarrkirche wurde von den Trümmern befreit und bald konnte wieder Gottesdienst in ihr gefeiert werden. Am 25. April konnte die Markusbittprozession wieder ungehindert zur Büschkapelle gehen. Mit großer Feierlichkeit wurde die Fronleichnamsprozession durch die noch erhaltenen Straßen der Stadt gehalten. Der Wiederaufbau der Kirche begann. Der Kleeberg, der durch Bomben zerrissen war, wurde durch starke Mauern und Beton befestigt. Gefangene deutsche Soldaten waren die ersten Arbeiter. Gerne halfen sie und waren dankbar für Nahrung und Kleidung, die ihnen dafür gewährt wurde. Am Pfingstfeste wurde der Kirchengemeinde von der Zivilgemeinde die Christusglocke wiedergegeben und in den Turm gehängt. Die Anstrengungen der Caritas wurden durch große Spenden an Schuhen, Kleidern und Nahrungsmitteln aus Chile zur fühlbaren Hilfe für viele. Dort hatte Pater Josef Kühl aus Gees eine Caritas-Hilfsaktion für Deutschland ins Leben gerufen.
Mit einem Wort gesagt, die Kirche lebte; sie wai nicht tot. Sie zeigte ihre Unzerstörbarkeit und Unvergänglichkeit. Eine große Freude für die Stadt war der Besuch von Erzbischof Dr. Franz Rudolf Bornewasser.
Hier sind nun die wichtigsten Ereignisse dieser Zeit festgehalten. Es verbergen sich in ihnen bunte Einzelszenen, vor allem viele Einzelschicksale von Menschen, die dieses alles erleben und ertragen mußten. Über sie läßt sich eher im engsten Kreise erzählen als schreiben. Gebe Gott, daß die Stadt und wir Ähnliches oder noch Schlimmeres nicht mehr erleben müssen.
Hillesheim 30 Jahre später ...
Die ersten Bomben auf Hillesheim fielen am 29. September 1944. Dem Fliegerangriff vom 19. Dezember 1944, den der Flecken fast schadlos überstand, folgte am Heilig-Abend ein weiterer Angriff, der den Ortskern traf. Einige landwirtschaftliche Betriebe wurden vernichtet, die Pfarrkirche beschädigt und die historische Stadtmauer an der Burglehn sank in Trümmer. Am 26. Dezember folgte ein Angriff auf das Bahnhofsviertel mit Molkerei und Sägewerk. Fünf Wohnhäuser brachen zusammen. Laufende Störangriffe auf Truppenbewegungen zwangen die Bevölkerung zum Teil in die nahen Bunker des Westwalls oder Schutzstollen in den Wäldern. Bordwaffenbeschuß brachte am 24. Januar einen getarnt abgestellten Munitionszug zur Explosion. Pionier-Sprengmunition detonierte und richtete im weiten Umkreis und im Ort erhebliche Schäden an. Tags danach erfolgte ein Angriff auf eine Kfz-lnstandsetzungsstaffel. Bei einem Nachtangriff am 24. Februar 1945 fanden 40 Soldaten den Tod. Als am gleichen Tage die ersten Artilleriegranaten des Feldheeres das Zerstörungswerk in den Mauern Hillesheims fortsetzten, verzeichnete die Bilanz der Angriffe 32 Ziviltote neben ungezählten Verletzten.
Hillesheim 30 Jahre später. Wer jene Zeit nicht miterlebte, vermag kaum den Anschluß zu finden an die Schreckenszeit, die schlechthin den Glauben an den Wiederaufstieg zunichte machte. Doch Hillesheim fand zurück zur Aufstiegssphäre, die in vergangenen Jahrhunderten dem Eifeler Marktort weithin zu bestem Ruf verhalf. So ist es geblieben bis heute ...
Noch lange werden in den Jahrbüchern des Kreises Daun die Verwüstungen des Krieges wach gehalten werden müssen, um der Nachwelt die einmaligen Wiederaufbauleistungen aufzuzeigen. Denn wie in Daun, Gerolstein und Hillesheim, die hier für gleiches Leid und gleiche Not der Bevölkerung auch in den neuen Regionen der VG Obere Kyll und der VG Kelberg Pate stehen, so hinterließ der Krieg auch dort ähnliche Trümmerfelder. In nebenstehender Tabelle sind die Opfer des Lebens aus dem gesamten Raum der Verbandsgemeinde des Altkreises Daun zusammengefaßt.
Weiter Weg zum Wiederaufbau
„Die Eyffel hat ihres Gleichen in der Welt nicht. Sie wird ihrerseits Lehrer werden, manche andere Gegend zu begreifen; und ihre Kenntnis kann gar nicht umgangen werden, wenn man eine klare Ansicht der vulkanischen Erscheinungen auf Continenten erhalten will."
Die Gefallenen und Vermißten des ersten Weltkrieges 1914/18
und des zweiten Weltkrieges 1939/45
in den Verbandsgemeinden des Altkreises Daun
|
Verluste des 1. Weltkrieges 1914-1918 |
Verluste des 2.Weltkrieges 1939-1945 |
||||||
|
Soldaten |
Soldaten |
Zivilpersonen Gefallene |
Zusammen | ||||
| Verbandsgemeinde | Gefallene | Vermißte | Zusammen | Gefallene | Vermißte | ||
|
Daun |
286 |
39 |
325 |
404 |
203 |
127 |
734 |
|
Gerolstein |
205 |
10 |
215 |
405 |
155 |
162 |
722 |
|
Hillesheim |
176 |
20 |
196 |
217 |
106 |
62 |
385 |
|
Lissendorf in Birgel |
118 |
9 |
127 |
265 |
61 |
52 |
378 |
|
Gillenfeld |
169 |
13 |
182 |
225 |
97 |
12 |
334 |
|
Niederstadtfeld |
151 |
12 |
163 |
203 |
81 |
48 |
332 |
|
Kreis |
1105 |
103 |
1 208 |
1719 |
703 |
463 |
2885 |
Diese Erkenntnis schrieb 1820 der Vater der Eifelforschung nieder: Leopold von Buch. Sie ist wegweisend geblieben bis heute, da die Wirtschaft aus dem vielfältigen Born der Bodenschätze existenzielles Leben speist. Das Entwicklungsland Eifel ist seit 1950 im Aufbruch. Die Natur hat der Eifel zwei Entwicklungsbasen geschaffen: Die Nutzung der Bodenschätze und die Sucht, dieses Land zu sehen und zu erleben.
Im Zeitraffer betrachtet: Vom Devonmeer zum Vulkanismus vergingen Millionen Jahre. Das erkaltete Magma der Lavaströme bereicherte vor etwa 12 000 Jahren unsere Heimat um die Basalt und Lavakegel ... und um jene kesseiförmigen Krater, die uns die Maare bewundern lassen. Etwa 5000 Jahre sind vergangen, seit die ersten Siedler den kargen Boden kultivierten. Erst knappe hundert Jahre währt der Prozeß, die Urbarmachung zu vollenden. In diesem Zeitaufriß begleitet der Basalt die Kulturgeschichte des Kreises Daun. Die Verwertung des Dolomitgesteins zwischen Kyll und Ahr schreitet über Kalk und Zement zu neuen Produktionen. Und die Nutzung der Mineralquellen hat den Namen „Eifel" in neun Jahrzehnten populär gemacht. Wald und Flora bilden im urwüchsigen Panorama der Landschaft verlockende Ziele zur Erholsamkeit.
Kampf ums Oberleben
Doch all dies war zu Ende des Krieges weitgehend der wirtschaftlichen Nutzung entzogen. Der Kampf ums Überleben beschränkte sich zunächst auf die Überwindung des Hungers. Leere gähnte aus allen Depots und aus den Ruinen, deren Dächer der Kriegssturm hinweggefegt hatte. Auf 36000 Einwohner war die Bevölkerung des Kreises Daun 1945 zusammengeschrumpft. Fast 3000 Kriegstote und Vermißte in der Heimat und an der Front waren die Trauerbilanz des Krieges. Tausende Schwer- und Leichtverletzte suchten hilflos nach der schützenden Hand. Das trostlose Bild wurde erhärtet von rund 2200 zerstörten Gebäuden. Ein Drittel allen Wohnraums lag in Trümmern. In der Hälfte aller Schulen ruhte wegen der Zerstörung der Unterricht. 40 von 104 Kirchen des Altkreises lagen am Boden. 57 zerstörte Straßen- und Eisenbahnbrücken lahmten den Verkehr. 186 Kilometer an zerrissenen Hochspannungsleitungen und über 50 defekte Ortsnetze des RWE vervollständigten den Ruin. Noch erhaltene Wirtschaftsgüter fielen in die Hände der Demonteure und Requisiteure der Besatzungsmächte. Man muß sich, will man Rückschau halten, dieses Bild jeweils neu vergegenwärtigen.
Den Kriegsschäden im baulichen Bereich standen ebenso schwerwiegende auf dem Sektor der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft, in der Kommunalwirtschaft, in den Gewerbezweigen und den industriellen Produktionsstätten zur Seite. Die Landwirtschaft, die schon durch die kriegsbedingte Viehabgabe von über 7000 Stück Schlachtvieh, rund 2500 Schweinen und über 6000 Stück Kleinvieh bis 1945 in ihrer Leistungsfähigkeit zur Ernährung hart geschmälert war (ganz abgesehen von unbebauten Ländereien), mußte von 1945 bis 1947 erneut an Rindern, Kälbern, Schweinen und Schafen ein Schlachtgewicht von 1126 Tonnen abliefern. Die Milcherzeugung schrumpfte 1945 bei 13365 Kühen um 3,5 Millionen Liter Ablieferung, und das Ablieferungssoll erhöhte sich 1947 bei nur 11 565 Kühen auf 6,8 Millionen Liter Milch. Katastrophaler Futtermangel 1947 und überhöhte Wildschäden verminderten nicht nur die Leistungsfähigkeit des Viehes, sondern auch dessen Gesundheitszustand. Die Nachzucht stockte.
Die Waldwirtschaft der Gemeinden, vom überhöhten Holzeinschlag bis zu 250 Prozent des normalen Hiebsatzes seit 1935 bereits angeschlagen, unterlag nicht nur der Dezimierung der Waldbestände durch Kriegseinwirkungen, sondern viel schmerzlicher waren die (buchstäblich zu verstehenden) Besatzungshiebe, die riesige Kahlflächen schufen. 350 Hektar Kahlflächen und der dadurch bedingte massenhafte Aufmarsch des Borkenkäfers machten die Kriegsfolgelasten allzu sichtbar. Die Mindereinnahmen der Gemeinden steigerten sich in Millionen-Beträge. Jagd und Fischerei sanken im Verbund mit den Wildschäden bis in die 50er Jahre zur Bedeutungslosigkeit ab.
In der Jünkerather Gewerkschaft (der DEMAG-Maschinenfabrik), die durch Bomben schwer beschädigt war, fielen 27 Maschinen der Demontage zum Opfer. Von den sieben Mineral- und Kohlensäurewerken waren in Gerolstein zwei total zerstört. Der Flaschenpark aller anderen Betriebe bestand zur Hälfte aus Scherben. Ablieferungen und Beschlagnahmen im privaten Bereich sowie die Bereitstellung von Wohn- und Büroraum samt Mobilar für die französische Besatzung und deren Unterhaltung verursachten zu der Versorgung der Flüchtlinge und Evakuierten einen öffentlichen Kostenaufwand, der das Leistungsvermögen schlechthin überstieg. Not und Elend waren in jeder Familie zu Gast, die wirtschaftlichen Verhältnisse auf dem Nullpunkt.
Mit Zwangswirtschaft zur Währungsreform
Ablieferung, Beschlagnahmen und die durch den Flüchtlingsstrom bedingte Zerrüttung sowie die von der französischen Besatzungsmacht eingeleitete politische Säuberung der Verwaltung plus Entnazifizierung mit Verunglimpfung und Denunziation ließen nach Kriegsende wenig Hoffnung auf die Wiederherstellung normalen Lebens. Rationierte Lebensmittel, Volksküchen und ähnliche Einrichtungen zur Ernährung der mit Aufräumungsarbeiten beschäftigten Bevölkerung vermochten den Hunger nicht aus der Welt zu schaffen. So blieb den Einheimischen wie den vielen Flüchtlingen aus den bis zum Kriegsende luftgefährdeten Ballungsräumen nichts anderes übrig als zu „organisieren", was immer zum Lebensunterhalt beitragen konnte. Die Begriffe „Mein und Dein" waren ohnehin ob der Gesamtnot verschwommen. Daraus erwuchsen Hader, Neid und vielfach Haß, Mißgunst. Von Haus zu Haus nagte der Wurm der Not.
Die Macht des Hungers kennt nur, wer diese am eigenen Leibe verspürte. Aber vielleicht war gerade dieses Erleben in Verbindung mit dem Druck der Besatzung die Keimzelle zur Besinnung auf die Kraft gemeinschaftlichen Handelns. Not lehrt beten, sagt ein Sprichwort und sie macht ebenso erfinderisch. Der Worte Sinn wurde bestätigt in ungezählten Aktionen, die darauf abzielten, das Leben in Not erträglich zu machen. Daß dabei dem religiösen Halt im Einzelnen wie in der Gemeinschaft erhöhte Bedeutung zukam, kann und darf nicht übersehen werden. Die Jahre vom Kriegsende 1945 bis zur Währungsreform entsprachen mehr einem Vegetieren von Tag zu Tag denn einer zielstrebigen Planung zum Wiederaufbau. Es waren die Jahre des Aufräumens, des Fertigwerdens mit dem Schicksal, das fast jede Familie in die Zange genommen hatte; nicht nur in der Sorge ums tägliche Brot, sondern auch in den Ängsten um die noch nicht heimgekehrten Söhne, Väter, Frauen, Mütter, Töchter und Kinder, die der Krieg irgendwohin versprengt hatte. Und die Zwangswirtschaft allein machte nicht satt. Es bedurfte dazu gegenseitiger Hilfen, vor allem um Seuchengefahren abzuwehren und die Krankheitsanfälligkeit der Bevölkerung infolge des Hungers zu überwinden. Was allein auf dem Sektor des Gesundheitswesens in jenen Jahren von Verwaltungsstellen und Behörden, Ärzten und dem DRK geleistet wurde, kann keine Statistik deutlich machen. Doch einige Zahlen, den Berichten der Kreisverwaltung entnommen, sprechen für sich: Von den 87 Wasserwerken im Kreisgebiet waren 28 zerstört, einige erheblich beschädigt. Defekte Kanalisationen, vor allem in den größeren Orten, erhöhten die Seuchengefahren. In zwei Orten erkrankten 23 Personen an Typhus. Drei der Erkrankten starben. Infolge der schlechten Ernährung und Kleidung nahm die Tuberkulose der Lungen und des Kehlkopfes zu. 1945 waren 29 Personen dieserhalb in Behandlung; 1947 stieg die Krankheitsziffer auf 74 Personen. Bei 31 Bürgern war Tuberkulose die Todesursache. Insgesamt wurden 1947 infolge Tuberkuloseerkrankungen 1124 Personen ärztlich betreut. Heilverfahren waren bei 27 eingeleitet, doch wirkten sich die Zonengrenzen hemmend auf die nötigen Heilstättenkuren aus. An Scharlach erkrankten in dem Berichtsjahr 53 Personen.
Politische Säuberung
Indes drängte die Besatzung auf die politische Säuberung der Verwaltung. 1946 lagen dem dazu gebildeten Ausschuß 1251 Fragebogen zur Bearbeitung vor. Bei deren Überprüfung bei der Bezirksregierung Trier wurden im Bereich des damaligen Kreisgebietes 131 Beamte aus dem Dienst entlassen, 25 vorzeitig in den Ruhestand versetzt, 507 im erreichten Berufsstand zurückgestuft und 588 Personen im Amt belassen. Eine nicht genau bekannte Anzahl von Personen wurde durch die Besatzung verhaftet und in den Internierungslagern Idar-Oberstein und Diez an der Lahn festgesetzt. Ihr Schicksal, soweit diese überlebten, klärte sich erst nach Jahren.
Während 1948 im Kreisgebiet noch über 800 Flüchtlinge zu betreuen waren neben 456 heimgekehrten Kriegsgefangenen, bewegte sich die Zahl der noch in Kriegsgefangenschaft befindlichen Kreisbewohner um 820 und von 825 Soldaten lag Vermißtenanzeige vor. Es währte bis 1951, bis sich die Zahl der noch nicht heimgekehrten Kriegsgefangenen auf 20 verringert hatte.
Von gewerblicher Wirtschaft konnte in den ersten Jahren der Nachkriegszeit nicht gesprochen werden. Das Eisenbahnnetz war durch die vielen Brückenzerstörungen lahm gelegt, der Transport mit Kraftfahrzeugen durch zerstörte Straßen gelähmt gelähmt auch durch den Mangel an Kraftstoff und Reifen. Erst die Umstellung der Motoren auf Holzvergaser-Antrieb ließ wieder Kfz-Transporte in beschränktem Umfang zu. Ansonsten beherrschten die Fahrzeuge der Besatzungstruppen die aufgewühlten Straßen. Die Hälfte des Netzes der elektrischen Stromversorgung lag am Boden; zwei Drittel der Transformatorenstationen waren zerstört oder beschädigt. Allein in Gerolstein waren 95 Prozent aller Handwerksbetriebe zerstört; in Daun bewegte sich der Zerstörungsgrad beim Handwerk um 50 Prozent.
Wertloses Geld ...
Nicht besser erging es den Einzelhandelsbetrieben sowie den Gaststätten. Nur etwa ein Dritte] dieser Betriebe war noch intakt, doch nur bedingt wirtschaftsfähig. Hier erwies sich, wie wertlos Geld sein kann, wenn der Nachschub an Gütern des täglichen Bedarfs aussetzt. Die Zwangswirtschaft mit ausgeklügelter Kalorien-Skala (zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel) war zwar nicht zu umgehen und schon während des Krieges geübt, doch vermochte sie nicht, den Erfordernissen der Ernährung gerecht zu werden. Denn was in den Kriegsjahren ob weitsichtiger Planungen auf dem Ernährungssektor der Bevölkerung zur Verfügung stand, war in den letzten Kriegsmonaten, als zusätzlich rund 20000 Soldaten und 17000 Arbeitskräfte versorgt wurden, weitgehend aufgezehrt. Selbstversorgung war rund der Hälfte der Kreisbevölkerung vorbehalten, nahezu 5000 Personen waren ate Teilselbstversorger eingestuft und 1000 Bürger waren auf Gemeinschaftsverpflegung angewiesen.
Doch diese Zahlen der „Normalverbraucher" täuschen, wie ein Beispiel der Eierwirtschaft verdeutlicht: Von der Eierablieferung war je Selbstversorger und Haushalt ein Huhn befreit; von jedem weiteren Huhn mußten jährlich 60 Eier abgeliefert werden. Das Ablieferungssoll steigerte sich je Huhn bis 1948 auf jährlich 75 Eier, bei Nichtselbstversorgern auf 40 und bei städtischen Hühnerhaltern auf 15 Eier. Von 1945 bis zum Frühjahr 1948 wurden auf diesem Wege der Zwangsbewirtschaftung der Eigenversorgung der heimischen Bevölkerung über 1,5 Millionen Eier entzogen. Ähnlich hart griff die Ablieferungszange bei Fleisch und Fett und vielen anderen Ernährungsgütern heimischer Erzeugung zu, ungeachtet des Mangels an Hausbrand und der vielschichtigen Skala des Bedarfs an täglichen Gebrauchsgegenständen, die zur Rarität wurden. Die Zuteilung von 40 Gramm Tabak pro Person (im August 1947 auf monatlich 60 Gramm erhöht) mag Pate dafür stehen, daß auch auf dem Genußmittelmarkt (wie bei Spirituosen und Wein) die Zwangswirtschaft keine Entspannungsstunde zuließ. Solche waren im Besatzungsstatut nicht einkalkuliert, sondern den Siegern vorbehalten.
Die Hamsterbewegung
Doch nachbetrachtet erwies sich der Verbund des Mangels an Lebensmitteln, täglichen Gebrauchsartikeln, Handwerksgerät, Baumaterialien und Genußmitteln als Motor des Tauschhandels. Die Vielzahl von Verboten, mit denen die Besatzungskommandanturen die Hungernden in Schach hielten oder aber das Chaos zu verhindern hofften, regten die Betroffenen zwangsläufig zur Unterwanderung an. Da viele Anordnungen sich als sinnwidrig erwiesen, entfaltete sich zur Oberwindung der Not eine Hamsterbewegung, wie sie die Geschichte in diesem Ausmaß wohl in keiner Epoche gekannt hat. Hamstern mit Geld oder Tauschobjekten zur Überwindung des Mangels an Lebensmitteln und Tagesbedarf setzte ungezählte Familienangehörige in Bewegung, zu Fuß, per Fahrrad, mit Handkarren und allen nur erdenklichen Vehikeln. Viele nahmen das Risiko der Überschreitung der nördlichen britischfranzösischen Zonengrenze auf sich. Daß dabei auch die deutschen Behörden, denen die Einhaltung der Besatzungsanordnungen oblag, ebenso in Gewissenskonflikte gerieten, versteht sich von selbst. Doch auch dort saßen viele Beamte, die hungerten und deshalb von Einzelgängern abgesehen weitgehend Verständnis für die Eigeninitiative der Bevölkerung aufbrachten und eben nicht alles sahen, was verbotener Weise unternommen wurde. Ja, es blieb festzustellen, daß sich in manchen Bereichen, je nach dem Verhältnis zwischen deutschen Dienststellen und französischer Kommandantur, bis 1947/48 ein stilles Dulden der Hamsterfahrten entwickelte, denn da und dort hatten die Franzosen erkannt, daß in dem ausgebrannten und ausrequirierten Land der Eifel eben nicht mehr herauszuholen war. So konnten auch manche Besatzungswünsche, mit denen einheimische Behörden konfrontiert wurden, nicht auf legalem Wege erfüllt werden. Denn die Wunschzettel der Sieger waren groß und so verschlossen auch sie die Augen, wenn es um eigene Anliegen ging, die auf dem Wege des Befehlens nicht zu erfüllen waren. Dem Nackten läßt sich nichts aus der Tasche holen.
Aufräumungs-Epoche
So umschlossen die Jahre nach dem Kriege bis zur Währungsreform die Aufräumung der Berge von Kriegsschutt, die notdürftige, provisorische Aufrichtung zerstörter Straßen- und Eisenbahnbrücken, die Instandsetzung des Stromnetzes, die Wiederaufnahme der Postzustellung, die Aufbereitung brachliegender Ländereien und Viehweiden sowie die Ingangsetzung der Wasserversorgungsanlagen und Kanalisationen. Über drei Jahre hinweg währten die Gemeinschaftsarbeiten zur Auffüllung der Bomben- und Granattrichter im Straßennetz. Und nur langsam flössen die Materialien, um teilzerstörte Gebäude wieder bewohnbar zu machen. Eine besondere Härte stellten die Requisitionen an Mobilar für die Besatzung dar. Verschiedentlich versuchte die Kreisverwaltung Wäsche und Möbel aus der englischen Zone zu beschaffen sowie Einrichtungsgegenstände, um einer Anzahl hart betroffener Familien zu helfen, denn auch bei der Beschlagnahme von Wohnungen für die Besatzung wurde das Mobilar mitbeschlagnahmt.
Lichtblicke am Horizont
Erst mit der Belebung des politischen Lebens durch die Bildung der Bundesrepublik und die Währungsreform kam das gewerbliche Leben wieder zur Entfaltung. Zwar türmten sich auch dabei zunächst die durch den Geldmangel bedingten Schwierigkeiten wie eine Alpenlandschaft vor den Initiatoren auf, doch über die Ruinen zerstörter Städte und Dörfer, aufgebrochene Straßen und über die höchste Zahl in Trümmer gesunkener Brücken eines Landkreises in der Bundesrepublik führte der Weg zu einem Aufbauwerk, das 1949 im Landkreis Daun unter der Regie von Landrat Johannes Feldges den Aufbruch zu wirtschaftlicher Neuordnung einleitete. Parallel dazu entfalteten sich die Kräfte zur Wiederbelebung des Schulwesens, der Kulturpflege und des bis dahin immer noch genehmigungspflichtigen Vereinslebens. Die jahrelang währende und noch nur gemilderte Not hatte dem Gemeinschaftsgedanken neue Impulse gegeben. Nur daraus erwuchs die Kraft zu jenem Aufbauwerk, das Wunden des Krieges vergessen läßt. So bleibt dem Chronisten nur Bedauern über notwendige Einschränkungen, wiewohl denn auch die Jahre der Not nicht der Kuriositäten entbehrten, die nachbetrachtet zum Schmunzeln anregen. Aus dem bitteren Ernst des Lebens schuf der Wiederaufbau, an dem jeder an seinem Platz initiativ und strebsam beteiligt war, verjüngte Städte und Dörfer, deren Wiederaufbau und wirtschaftliche Entfaltung in den Jahren von 1950 bis 1965 einer umfassenden Darstellung im nächsten Jahrbuch bedarf.