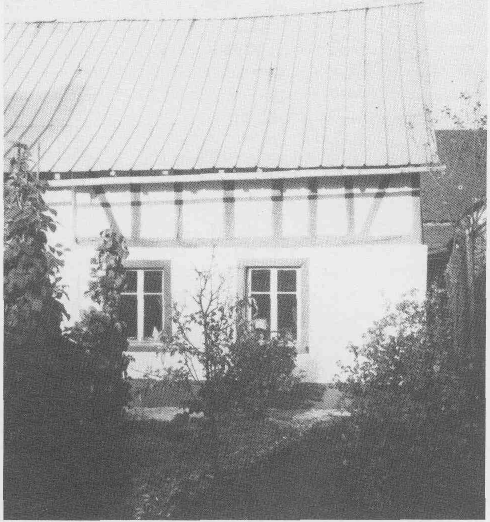
Häuser, die verrückt geworden sind
Franz Josef Ferber
Es gibt schon viele Merkwürdigkeiten in unserem menschlichen Dasein! Gesetzt den Fall, man erzählte heutzutage jemandem etwas von „verrückt gewordenen" Grenzsteinen. Man würde ob eines solchen sprachlichen Ausdruckes bestimmt mitleidig belächelt oder gar für einen Witzbold gehalten werden. Und dennoch ist es wahr: Eine derartige Formulierung kommt in keinem geringeren, als in dem Buch vor, das unsere privaten Rechtsverhältnisse regelt, nämlich im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), genau gesagt, im Paragraphen neunhundertneunzehn. Gewiß, dieser Ausdruck ist veraltet, geht er doch auf die erste Fassung dieses bedeutenden Gesetzeswerkes aus dem Jahre 1896 zurück; die Zeitgenossen unserer Tage kann er zum Schmunzeln anregen.
Was hat dies nun mit den folgenden Geschichten zu tun? Sehr viel! Es hat hiermit insofern etwas gemeinsam, als hier zwar keine Grenzsteine, dafür aber eine stattliche Anzahl Bausteine, besser gesagt, Baumaterialien, Häuser also, „verrückt wurden". Dabei handelte es sich keineswegs um Bausteine, Bauholz oder Teile von sogenannten Fertighäusern, die vom Lagerplatz eines Baustoffhändlers zur Baustelle transportiert wurden. Oh nein! Das Baumaterial, von dem an dieser Stelle die Rede ist, war bereits einmal, wenn nicht in dem einen oder anderen Falle sogar öfters, zu fertigen, bewohnbaren Häusern verbaut gewesen.
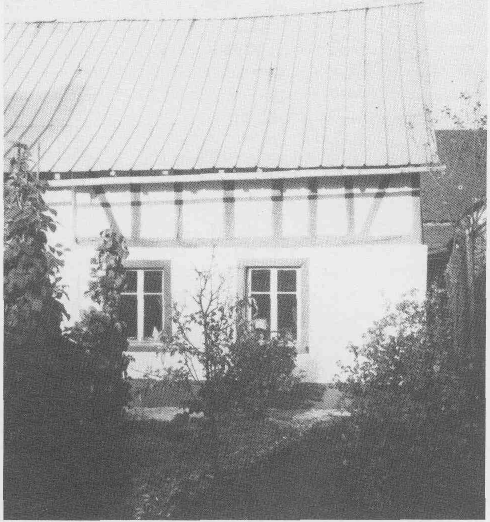
Hinterfront Haus Bung in Utzerath, 1976
Josef Lion erzählt uns in „DIE EIFEL", Jahrgang 1975, Seite 308) die volkskundlich interessante Geschichte von einem prächtigen Fachwerkhaus, das einstmals in Boos stand, und das ein Zimmermann aus Kirchesch im Jahre 1836 kaufte, es abriß und in seinen zirka dreißig Kilometer entfernten Heimatort transportierte, um es dort naturgetreu wieder aufzubauen. Der Verfasser des Beitrages folgert, daß es für eine derart enorme Leistung „wohl wenige Beispiele" geben dürfe.
Nun, es soll keineswegs bestritten werden, daß dieser Fall, so wie er individuell geprägt dasteht, einzigartig ist. Ansonsten scheinen die Fälle oben geschilderter Art im vergangenen Jahrhundert nicht einmal so selten gewesen zu sein. Die nachfolgenden Beispiele beweisen dies; sie betreffen einen verhältnismäßig engen geographischen Raum. Von daher gesehen ist es einigermaßen verwunderlich, daß diese Begebenheiten allgemein, sogar hier und da bei heimatgeschichtlich Kundigen, weitgehend unbekannt sind und mehr und mehr in Vergessenheit zu geraten drohen.
Zugegeben, es ist nichts Außergewöhnliches, wenn heutzutage ganze Häuser transportiert werden. Von den Fertighäusern einmal abgesehen, ist es fast alltäglich, daß man alte Häuser, die irgendwo in einem Dorf abgebrochen werden, in Freilichtmuseen schafft, um sie dort wieder im alten Zustand erstehen zu lassen. Daß man aber schon vor hundert und mehr Jahren ganze (wohl gemerkt!), noch oder gerade bewohnbare Fachwerkhäuser abbaute, sie nicht selten über weite Wegstrecken transportierte und sie im vorigen Zustand wieder aufbaute, dürfte beim damaligen Stand der Technik außerordentlich bemerkenswert sein.
Die Gründe für das „Verrücktwerden" der Fachwerkhäuser waren unterschiedlich. Zu-' meist schien aber ein beabsichtigter Wohnortwechsel des Besitzers vielfach zum Zwecke der Heirat der Beweggrund gewesen zu sein. Auch war in dem einen Fall die Arbeit ungleich mühsamer wie im anderen. Denn bekanntlich gab es in der Eifel verschiedene Arten von Fachwerkhäusern und der Ab- und Wiederaufbau eines kleinen Hauses war nun mal leichter zu bewerkstelligen wie beispielsweise der eines größeren Bauwerkes. Und schließlich war es nicht egal, ob zwischen der alten und der neuen Baustelle die Wegeverhältnisse gut oder schlecht waren.
Das Haus Bung in Utzerath („Bunge")
Dieser Fall ist im besonderen dazu geeignet, die Materie darzustellen. Es handelt sich hier wie bei dem unten beschriebenen Fall aus Gefell um einen geradezu typischen Fall des „Häuser-Verrückt-Werdens". Nebenbei enthält er einen interessanten Berufsweg eines der Ahnen der betreffenden Familie.
Im Jahre 1795 wanderte ein Schwede namens Anton Bung aus seiner Heimat nach Deutschland aus. Er war von Beruf Mühlenbauer. Mit seinem Ochsen- oder Pferdekarren zog er durch die Eifel von Mühle zu Mühle. An den damals sehr zahlreichen Eifel-Mühlen gab es immer etwas zu reparieren. Da und dort mußten auch neue Mühlen gebaut werden. An Arbeit hat es diesem fleißigen Handwerksmann bestimmt nicht gemangelt. Seine persönlichen Bindungen zu dieser damals weithin unbekannten Landschaft gestalteten sich derart günstig, daß Anton Bung für immer hier Fuß faßte. Er heiratete Fräulein Clara Frantzen aus Meiserich (heute Gemeinde Ulmen). Dort, im Uessbachtal, wo zahlreiche Mühlen standen, ließ er sich nieder.
Matthias Bung („Bunge Mattes"), geboren am 4. Februar 1847, trat, beruflich gesehen, nicht in die Fußstapfen seines Großvaters Anton Bung. Er wurde nicht Mühlenbauer, sondern aus ihm wurde ein tüchtiger Schreiner, der in der näheren und weiteren Umgebung mit Aufträgen bedacht wurde. Da die Handwerker früher ihre Arbeiten (zum Beispiel: den Möbelbau) vielfach an Ort und Stelle, das heißt im Hause ihres Auftraggebers, verrichteten, kamen sie viel herum. Auf einer solchen Arbeitsreise lernte Matthias Bung seine spätere Lebensgefährtin, Fräulein Anna Maria Petry, geboren am 23. Januar 1849, aus Utzerath kennen. Diese heiratete er am 27. Januar 1872. Und damit beginnt die eigentliche Geschichte.
Matthias Bung besaß in Meiserich ein eigenes Haus, das er vermutlich von seinen Vorfahren geerbt hatte. Die Jungvermählten waren sich darüber einig, daß ihr Heim fortan in Utzerath sein sollte. Daraus ergab sich zwangsläufig die Frage: Was tat das Haus des jungen Mannes nun noch in Meiserich? Also entschloß man sich, es dorthin zu schaffen, wo es in Zukunft gebraucht werden würde: nach Utzerath. So ganz reibungslos konnte die sich selbst gestellte Aufgabe jedoch nicht gelöst werden. Immerhin erforderte das nicht gerade unproblematische Werk gründliche Vorbereitungen, die noch einige Zeit in Anspruch nehmen sollte. Vor allen Dingen mußte ein geeigneter Platz zur Verfügung stehen, auf den man das „neue" Haus stellen konnte. Mit diesem Problem wurde Mattes, geschickt wie er war, schnell fertig. Da er durch sein einträgliches Handwerk zahlungskräftig und er in Utzerath angesehen war, verkaufte man ihm dort bereitwillig ein Grundstück. Dieses war zwar etwas knapp bemessen, dennoch reichte es aus, um hierauf ein bescheidenes Haus zu errichten und später noch ein kleines Ökonomiegebäude anzubauen. Bis dahin waren nun seit der Heirat ungefähr zwei Jahre vergangen, so daß man im Jahre 1874 mit dem großen Werk beginnen konnte. Mattes machte sich mit ordentlichem Fleiß daran, das Haus, dessen unteres Geschoß aus Mauerwerk, das obere aber aus einer Fachwerkkonstruktion bestand, sorgsam abzutragen. Mit Hilfe von Verwandten, Freunden und Bekannten, namentlich Meisericher Bewohnern, wurde anschließend das Material mit Pferde- und Ochsenfuhrwerken bergan nach Utzerath, eine Wegestrecke von zirka fünf Kilometern, gekarrt. Das war bei den dazumal allgemein bestehenden schlechten Wegeverhältnissen kein leichtes Unterfangen. Wohl manches Wagenrad mag dabei zu Bruch gegangen sein. Es wurde so ziemlich alles mitgenommen, was brauchbar erschien: vornehmlich die schweren Eichenbalken, die Türen, die Fenster, die Treppen, die Fußbodenbretter und, nicht zu vergessen, die zweigeteilte Haustüre. Aller Wahrscheinlichkeit nach befanden sich auch die Bruchsteine unter dem Transportgut; denn sie wurden schließlich für das Fundament und für den hohen Sockel, auf den das sogenannte Ständerwerk aufgesetzt werden sollte, benötigt. Was jedoch zurückgelassen wurde, waren außer dem vertrockneten Lehm die „Strohpuppen", aus welchen das Strohdach gefertigt war. In Utzerath sollte das Haus ein neues Dach, nämlich eine Schieferdacheindeckung, erhalten.
Nach getaner Arbeit begann die nächste Phase, die eigentliche Aufbauarbeit. „Der Eifeler Bauer", so schreibt Dr. Josef Janssen (im „Eifel-Heimatbuch" 1950), „baute sein Haus aus dem .gottgewollten' Material, dem Eichenholz seines Waldes, dem Lehm seines Bodens und dem Roggenstroh seines Feldes". Wie ein Fachwerkhaus auf die „Beine gestellt" wurde (und wird), wissen die Baumeister des Rheinischen Freilichtmuseums in Kommern am besten zu sagen:
,,. . . Auf den Steinfundamenten ruht das Fachwerk, das tragende Gerüst der Bauten ... Alle Verbände wurden früher nur durch Holznägel gesichert, kein Eisennagel findet sich an einem alten Fachwerkhaus. Die Wandfüllungen zwischen den einzelnen Hölzern des Fachwerkgefüges, in den .Gefachen' wie wir sagen, bestehen in der Regel aus einem lehmbeworfenen Flechtwerk. Man verfährt dabei so, daß zwischen den Riegeln zunächst stärkere senkrechte Staken aus gespaltenem Eichenholz eingefügt und diese dann mit daumenstarken Ruten verflochten werden. Schließlich wird das Geflecht beiderseits mit Lehm beworfen und das Ganze zum Schluß noch mit einem Lehmfeinputz überzogen und geglättet..."
(Führer des Rhein. Freilichtmuseums Kommern, Ausgabe 1966).

( Fachwerkhäuser in Hörschhausen um das Jahr 1940 (links , im Hintergrund: Haus Bretz-Simonis)
Das Haus Bung hat im Verlaufe der vielen Jahre einige äußere Veränderungen erfahren. Beispielsweise verschwand das schadhaft gewordene Schieferdach; es wurde durch ein Blechdach ersetzt. Geblieben aber sind die Fachwerkteile sowie die kleinen Fenster an der Stirnseite. Seit dem Jahre 1963, als der jetzige Eigentümer (Franz Bung, ein Ur-Ur-Enkel des schwedischen Einwanderers Anton Bung) nebenan einen Neubau bezog, steht das Häuschen leer; es dient als Abstellraum. Wer brächte es auch fertig, ein Bauwerk, mag es noch so bescheiden dastehen, abzureißen, das so viel Familiengeschichte in sich birgt und dem so viel Schweiß der Ahnen anhaftet? Man sollte als erfreulich vermerken, daß das besagte Haus noch ästimiert wird, nachdem es als Wohnstätte seine Schuldigkeit längst getan hat. Dies ehrt den Eigentümer.
Das Haus Bretz-Simonis in Hörschhausen („Zeduschens")
Das gleiche Schicksal, allerdings aus anderem Grund und mit einem unerfreulichen Ende, ist dem Wohnhaus der Eheleute Peter Bretz und Anna Maria geborene Simonis („Zeduschens") in Hörschhausen widerfahren, nur mit dem Unterschied, daß es nicht in die „Fremde vertrieben" wurde; es durfte auch fortan in seiner vertrauten Umgebung verweilen. Das Haus, ganz in Fachwerkbauweise gebaut, stand nach mündlicher Überlieferung bis etwa zur Mitte des vorigen Jahrhunderts gegenüber der alten Kapelle, etwa dort, wo der Gäsbach in den Uessbach einmündet. Es ist nicht überliefert, aus welchem Grund dieser Standort eines Tages nicht mehr passend war. Sehr wahrscheinlich ist die Ursache in der stetigen Hochwassergefahr zu suchen. Denn die Uess, die in dem etwa drei Kilometer entfernten Mosbrucher Weiher (Trockenmaar) entspringt, führte bereits in ihrem Oberlauf ob des wasserreichen Quellgebietes von jeher viel Wasser, woraus sich im übrigen die Tatsache erklären läßt, daß bereits am Oberlauf des Uessbaches verhältnismäßig viele Mühlen standen. Das konnte sich, begünstigt durch den Zufluß des Gäsbaches, der von Katzwinkel herkommt, besonders bei starken Regenfällen oder/und in der Zeit der Schneeschmelze für die angrenzenden Wohn- und Wirtschaftsgebäude sehr nachteilig auswirken. Noch in unserer Zeit, zum Beispiel bei dem Hochwasser am 30. April 1959, mußten Schweine aus einem Stall am Uessbach ,,evakuiert" werden. So entschloß man sich also aus gutem Grund, das Fachwerkhaus sorgfältig abzubauen und es zirka sechzig Meter seitwärts, in der Nähe der zu diesem Anwesen gehörenden Scheune (der früheren Zehntscheune, die im Jahre 1939 durch Feuer völlig vernichtet wurde), naturgetreu wieder aufzubauen. Der Plan wurde auch bald in die Tat umgesetzt. Das Bauwerk entstand in der alten Pracht, ein im Gegensatz zum Haus Bung zweigeschossiges, auf einem niedrigen Steinsockel aufgesetztes, Fachwerkhaus mit einer bildschönen, damals allgemein üblichen, doppelten Haustür, die man nach dem Zweiten Weltkrieg noch bewundern konnte. Dem aufmerksamen Betrachter konnte nicht entgehen, daß das Bauwerk zum zweiten Mal erstanden war. Daß die schweren, vierkantig gezimmerten Eichenbalken schon einmal verbaut gewesen sein mußten, war nämlich daran zu erkennen, daß sie an manchen Stellen leere Zapflöcher aufwiesen.
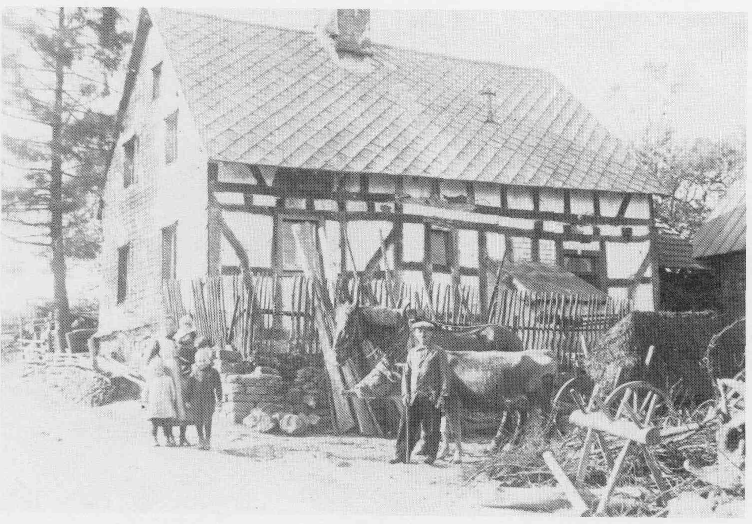
Haus Hens (früher Willwer) in Gefeil, 1925
Diejenigen, die dieses Werk vollbrachten, waren möglicherweise die Eheleute Jakob Simonis („Zeduschens Jockem") und Maria Katharina („Marej-Kätt") geborene Gerhartz, die Eltern der eingangs erwähnten Frau Anna Maria Bretz („Zeduschens Ammi"). Wahrscheinlicher ist jedoch, daß es der Großvater der eben genannten Frau Bretz gewesen ist, nämlich der am 3. November 1818 in Hörsch-hausen geborene Anton Gerhartz (Schreibweise auch: Gierhards), der in seinem Heimatdorf der „Stroth-Uhsda" genannt wurde.
Im Jahre 1957 mußte das Haus wiederum weichen, diesmal endgültig einem Neubau.
Das Haus Hens in Gefeil („Trappenantunns")
Es wird vielfach behauptet, früher hätten die Eifeler stets in ihrem Dorf untereinander geheiratet. Dies trifft sicher in vielen Fällen zu; es ist aber nur die halbe Wahrheit. Ein Blick in alte Heiratsregister zeigt, daß sich sehr viele Eifeler Jungmänner ihre Lebensgefährtinnen außerhalb ihres dörflichen Bereichs suchten. Es fällt dabei auf, daß die Dörfer des eigenen Kirchspiels (Pfarrei) bevorzugt wurden.
Fräulein Catharina Schneider aus Rengen, dort geboren am 7. Januar 1795, suchte sich ihr Lebensglück in einem kleinen Dorf ihrer Nachbarpfarrei (Beinhausen/Hilgerath), und zwar in Gefell. Dort heiratete sie am 26. Oktober 1820 den zwanzigjährigen Anton Willwer. Die junge Braut konnte sich glücklich schätzen, von ihren Eltern ein ansehnliches Haus geerbt zu haben. Aber was nutzte ihr ein Haus in Rengen, wenn sie in Gefell an der Seite ihres Ehemannes ihr Leben verbringen wollte? Was lag also nahe? Das Haus abzubauen, es nach Gefell zu schaffen und es dort wieder aufzubauen. Gesagt getan! Allein der Transport des Materials über eine Strecke von ungefähr zehn Kilometern muß als eine beachtliche Leistung bezeichnet werden. Denn zur fraglichen Zeit war Gefell wie unzählige andere Eifeldörfer nur über holprig-lehmige Feldwege zu erreichen, aus welcher Himmelsrichtung man auch kommen mochte.
Das schwere Brandunglück, das sich am Q.April 1921 in Gefell ereignete (es brannten damals drei Wohnhäuser, eine Scheune und drei Ställe teils mit lebendem und totem Inventar ab), hatte das Haus Willwer-Gerhards-Hens, ohne Schaden zu nehmen, überstanden. Aber fünfzehn Jahre später im Jahre 1936 war sein Schicksal besiegelt. Es ging ihm nicht besser wie vielen seiner Artgenossinnen: sein Eigentümer (Nikolaus Hens) riß es ab und baute an seiner Stelle ein neues Haus. Nichts (außer einer Fotografie) erinnert mehr daran, daß hier eines der typischsten Fachwerkhäuser unseres heimatlichen Raumes gestanden hat. Erhalten geblieben ist allerdings bis auf den heutigen Tag der frühere Hausname: ,,Trappenantunns"; er bedeutet, daß zum Hauseingang eine Treppe führte und der Erbauer „Anton" (Anton Willwer) hieß.
Die Scheune Mertes in Kolverath („Kreins")
Nicht nur Wohnhäuser, sondern auch Scheunen sah man früher als zum ,,Verrücken" geeignete Objekte an. Die „Kreins-Scheune" in Köttelbach bzw. Kolverath ist ein nachgerade klassisches Beispiel hierfür. Die Familie Krein (Schreibweise auch: Krain) erbaute im Jahre 1775 in Köttelbach (heute Ortsteil von Kelberg) eine Scheune aus Fachwerk. Viele Jahre später heiratete ein Angehöriger dieser Familie in Kolverath ein. Etwa zu dieser Zeit es soll ungefähr hundert Jahre nach der Erbauung, also um 1875, gewesen sein montierte man die Scheune in Köttelbach ab, schaffte sie auf die andere Seite des Hochkelbergs und baute sie dort in Kolverath wieder auf. Danach tat sie noch einigen Generationen ihre Dienste. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg hatte sie ausgedient, so daß man sie abriß. Das einzige, was von ihr über die Zeit gerettet werden konnte, war der kunsthandwerklich gestaltete Trägerbalken vom Toreingang; erträgt die Inschrift: „ANNO 1775 DEN 3 MAI" und ziert heute die Wohnung eines der Familienangehörigen Mertes (Nachfahre der Familie Krein) in einer Stadt am Rande der Eifel.

Eheleute Jakob und Maria Katharina Simonis vor ihrem Haus in Hörschhausen, vor 1900
Diesen vier Beispielen könnten mit Sicherheit weitere aus der näheren und ferneren Umgebung hinzugefügt werden. Es kommt dem Verfasser an dieser Stelle aber nicht auf eine vollständige Katalogisierung der „verrückt gewordenen" Fachwerkhäuser an, sondern darauf, an Hand weniger Beispiele aufzuzeigen, zu welchen großartigen Leistungen unsere Vorfahren fähig waren. Wir kommen nicht umhin anzuerkennen, daß unsere Ureltern unter schwierigen Umständen, unter Aufwand besonderen Fleißes und sicher mitden notwendigen Portionen Gottvertrauen Werke geschaffen haben, die auch, oder gerade im Zeitalter der Technik, Beachtung verdienen. Es ist unsere Pflicht, diesem Gechaffenen den ihm gebührenden Respekt entgegenzubringen. Viele trauern heute und das sicher nicht zu Unrecht den schönen und behaglichen Eifeler Fachwerkhäusern nach. Gottlob sind sie nicht alle verschwunden; soweit sie ganz oder teilweise noch existieren, werden sie als Kulturdenkmäler betrachtet. Aus diesem Blickwinkel gesehen, muß der Aufruf von Herrn Landrat Orth, sich für den Erhalt von Kultur- und Baudenkmälern im Kreis Daun einzusetzen und erhaltenswerte alte Bau- und Kultursubstanz zu nennen, als äußerst wohltuend empfunden werden. Der Aufruf des Dauner Landrats, unterstützt von dem Fachberater Herrn Dr. Bendermacher, kann aber nur dann einen Sinn haben, wenn wir alle ihn befolgen. Und das sollten wir unbedingt tun; denn das sind wir unseren Ahnen und unseren Nachkommen wahrhaftig schuldig!