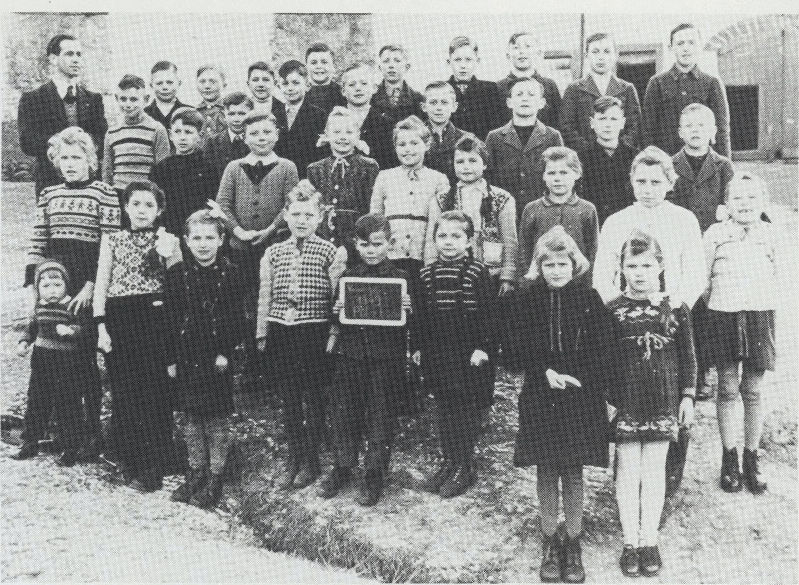
Erinnerungen an ein Dorf
Friedrich Gehendges
Warum eigentlich? Noch viele Jahre danach stellt sich ein heute Vierzigjähriger, ein ehemaliger Pützborner Junge, immer wieder die gleiche Frage, wenn er an seine Schulzeit in Gerolsteins St.-Matthias-Progymnasium zurückdenkt. Warum stieg eigentlich regelmäßig und unbarmherzig ein beklemmendes Gefühl, eine Art Scham in dem Jungen auf und trieb ihm die Röte ins Gesicht, wenn er vor versammelter Mannschaft nach seiner Herkunft gefragt wurde? Wie beneidete er seine Klassenkameraden, wenn diese bei gleicher Gelegenheit mit stolzem Unterton Städte wie Trier, Kyllburg oder das damals noch weit entfernte Völklingen als ihre Heimatorte verkünden konnten! Hätten doch die Lehrer ein Einsehen und fragten nicht immer nach dem Wohnort, sondern nach dem Ort der Geburt! Dann wäre die Angelegenheit weniger peinlich, da man in diesem Falle ebenso selbstbewußt Daun ins Feld führen könnte.
Daun! Ein Begriff, den zu kennen, man jedem einigermaßen in heimatlicher Geografie bewanderten jungen Menschen der fünfziger Jahre unterstellen durfte. Aber Pützborn? Ganz schlimm kam es über den nach seiner Herkunft Gefragten, wenn er der Deutlichkeit halber zum Buchstabieren des Ortsnamens aufgefordert wurde und eine kurze Lagebeschreibung dieses wohl nebensächlichsten Platzes in der Welt gegeben werden mußte. Selbst Dauner Mitschüler schienen die Seelenqualen eines Dorfjungen in fast sadistischer Weise zu genießen und hatten wer will es Kindern verdenken schon vergessen, daß noch wenige Jahre zuvor ihre Eltern vor dem Hunger der Nachkriegszeit gerade in solche Dörfer wie Pützborn flüchteten.
Und heute? Aus diesem damals so geschmähten Nest ist wirklich ein »Nest« im wahrsten
Sinne des Wortes geworden, in dem Dauner Bürger in zunehmender Zahl Zuflucht, Ruhe, Geborgenheit und nicht zuletzt jene Wärme suchen, die nur ein Nest bieten kann. Dreißig Jahre danach ist Pützborn ein begehrter Wohnplatz für Stadtmenschen geworden. Der ehemalige Pützborner Junge aber wohnt inzwischen in einer Kleinstadt, die sich selbstbewußt das »Tor zwischen Eifel und Mosel« nennt und diese Rolle überzeugend spielt. Er fühlt sich wohl in dieser aufstrebenden Kleinstadt, die ihm zur zweiten Heimat geworden ist; sein Dorf Pützborn aber sieht er nach zwanzig Jahren der Abwesenheit mit ändern Augen. Heute weiß er, daß die Kinder- und Jugendjahre im Dorf zwischen Warth, Kalk und Gönnerscheid zu den glücklichsten seines bisherigen Lebens gehören und auch damals nicht der geringste Anlaß gegeben war, die Herkunft aus der von anderen abschätzig belächelten Atmosphäre eines kleinen Dorfes nur zurückhaltend zuzugeben.Bei vielen seiner Besuche im elterlichen Haus am Pützbach führte ihn in den vergangenen Jahren ein Spaziergang durch die Straßen und Pfade seines Heimatortes und ließ in ihm Erinnerungen an Kindertage wach werden und Vergleiche zwischen damals und heute anstellen. Vieles hat sich verändert, und die Menschen erst recht die Kinder , die ihm auf diesen Wegen begegneten, waren ihm unbekannt. Es war nicht mehr so wie früher, daß man eine auch nur in der Ferne auftauchende Gestalt bereits von weitem erkannte und sich während der letzten Schritte vor der Begegnung schon eine freundliche Bemerkung zurechtlegte, mit der man den anderen zu grüßen gedachte. Selbst einem Ur-Pützborner wie dem Vater des Schreibers dieser Zeilen war es trotz geistiger Regsamkeit in den letzten Jahren seines Lebens nicht mehr möglich, jede inzwischen ortsansässige Person zu identifizieren, wenn er seinen Sohn auf dessen Wegen in Jugenderinnerungen begleitete.
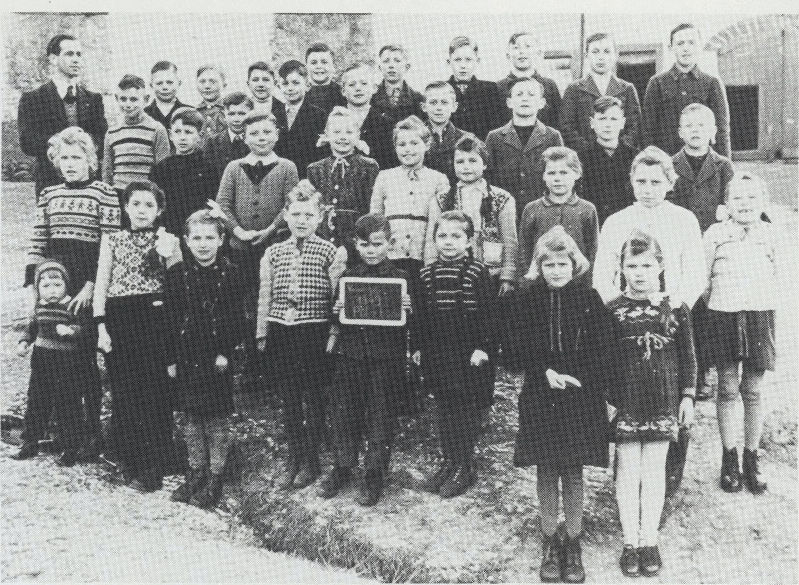
Die Volksschule Pützborn 1949 eine einklassige Zwergschule mit ihrem Lehrer Alois Hermes. Diese Generation wurde Augenzeuge des Wandels ihres kleinen Dorfes mit allen Vor- und Nachteilen.
So manches hat mein Dorf inzwischen von seinem ursprünglichen Charakter eingebüßt. Verlorengegangen sind vor allem das den Dorfbewohnern früher eigentümliche Zusammengehörigkeitsgefühl, das Sich-Kennen, das Sich-Mögen und Sich-Hassen, das Wissen um Vorgänge in jedem entlegenen Dorfwinkel und in jedem Haus und das nicht immer nur von Neugier geprägte Interesse am Geschick der Mitmenschen.
Die Atmosphäre ist steril geworden, nüchtern und unpersönlich. Frei von Schmutz sind die Dorfwege, die sich heute »Straßen« nennen dürfen und ein Bild bieten, das in meinen Kindertagen noch mancher Stadt zur Ehre gereicht hätte. Straßenschilder mit oft nichtssagenden Benennungen haben mundartliche Namen ersetzt, für die es keiner Beschilderung bedurfte, da jeder die »Milmet«, die »Schaft«, das »Schläfjen« oder die »Holl« kannte. Gerade der Staub der damals noch nicht befestigten Dorfstraßen, der sich unmerklich, aber unerbittlich bei jedem Gang durchs Dorf in Kleider und Haare hängte, mag im nachhinein wie ein Symbol für das Einbezogensein des Menschen in sein Dorf wirken.
Und dann kam der Abend, an dem zum ersten Male nach dem Kriege sich das blau-weiße Licht der Neonröhren über Wege und Höfe ergoß zweifelsohne ein weiterer Fortschritt. Aber entfremdete die nächtliche Taghelle die Menschen nicht wiederum ein Stück von »ihrem« Dorf? Wußte nicht bislang jeder nächtliche Heimkehrer auch bei völliger Dunkelheit erfolgreich allen vertrauten Schlaglöchern, Pfützen und Stolpersteinen auszuweichen, denen man nun mit einem Male keine Aufmerksamkeit mehr zu schenken brauchte? Ebenso sicher umging man zuvor auf den Höfen die Jauchepfützen, die Misthaufen, die abgestellten Ackerwagen und Holzstapel, wenn man mit oder ohne besonderen Anlaß einmal zur Nachtzeit einen Mitbürger aufsuchte. Das dumpfe Licht aus den noch nicht mit Rolläden gesicherten Fenstern bot auf den letzten Schritten sicheres Geleit zu der in den meisten Fällen trotz der Dunkelheit noch unverriegelten Haustür.
Solche Wege wurden oft unternommen in Zeiten, als das Fernsehen noch nicht alt und jung in die eigenen vier Wände bannte und jeder unverhoffte Besucher eine willkommene Abwechslung in den langen Abendstunden darstellte. Oft konnte dann kurz darauf ein Passant hinter vorgezogenen Vorhängen heraus jenes eigentümliche Geraune, Klopfen und Klatschen vernehmen, das ihm verriet, daß man sich wieder einmal zu einer der ungezählten Skatrunden zusammengefunden hatte. Es bedurfte damals keines Vereins, um diese bevorzugte Art der Geselligkeit zu pflegen, bei der mit allem Ernst und mit äußerster Erbitterung um Zehntelpfennige gerungen wurde. Nur ganz selten kam einmal ein Skatbruder ungelegen, und oft war dann die Küche bis spät in die Nacht hinein von den »Kartendreschern« in Beschlag genommen. Keiner von denen nahm es übel, daß man die »gute Stube« nur an Sonn- und Feiertagen »in Betrieb« nahm, auch wenn die Küche mit dem eben erst abgeräumten und noch un-gespülten Tischgeschirr im Spülbecken und den noch im engen Raum treibenden Essensgerüchen die ganze Zusammenstellung des bäuerlichen Abendmahls preisgab.
Heute ist man im Umgang miteinander reservierter geworden. Mit den »Kärtern« von damals, mit Treinen Juppes, mit Mayer Juppes, Schreiner Alois, Schreinisch Meerten, Leisbez Meerten, den Schmidtjungen und anderen Altersgenossen ist inzwischen die letzte Generation ins Mannesalter getreten, die sich noch weitgehend durch natürliche, dörfliche Unkompliziertheit in ihren mitmenschlichen Beziehungen auszeichnete.
Vorbei ist es auch mit einer anderen Idylle des Dorflebens. Die damaligen Dorfväter im Gemeinderat verfolgten durchaus ein löbliches Ziel, als sie Planung und Bau eines Gemeindehauses in Angriff nahmen. Was dieser nützlichen Einrichtung jedoch zum Opfer fiel, war die von Bäumen eingerahmte, altersschwache Bank auf dem Dorfplatz. Hatten sich hier an lauen Sommerabenden erst einmal einige wenige eingefunden, so dauerte es in den meisten Fällen nicht lange, bis sich ihre Zahl binnen kurzem auf die Mindeststärke eines dörflichen Gesangvereins erhöht hatte. Dann fehlte nur noch Scheez Hermann, bei dem es nicht vieler Überredungskunst bedurfte, um ihn mit seinem Akkordeon aus dem nahen Hause zu locken. Wie anders doch als das Geknatter von Mopedmotoren hörten sich dann die unermüdlich und ohne Proben in mehrstimmigem Gesang in den Abendhimmel aufsteigenden, damals noch jung und alt vertrauten Volksweisen an! Selbst im entferntesten Dorfwinkel konnte man ihnen lauschen, da der Lärm unserer motorisierten Zeit seinen Einzug in das kleine Dorf noch nicht gehalten hatte. Dann traten nach getaner Arbeit auch »Op der Mill« und in der »Hohnerjaß« die Menschen aus ihren Türen, setzten sich auf die unverzichtbare Bank vor ihrem Hause und summten die an ihr Ohr dringenden Melodien mit. Nächtliche Ruhestörung? Aber nein! Solche Liederabende zeugten vielmehr von der menschlichen Nähe in einer noch intakten Dorfgemeinschaft. Das einfühlsam und aus tiefster Überzeugung vorgetragene »Kein schöner Land« beschloß in der Regel solche Stunden der Geselligkeit und räumte schließlich mit »Nun, Brüder eine gute Nacht!« dem Abendfrieden sein Recht ein.
Hin und wieder trieb es die jungen Leute auch über die Grenzen des eigenen Dorfes hinaus. Hatte man sich wieder einmal »Auf der Kreuzung« oder »Auf der Bank« zu einer kleinen Runde zusammengefunden, so überließ man es oft einer hochgeworfenen Schirmmütze, mit ihrem Fallen die Wahl des Zielortes vorzunehmen. Dann machte man sich zu Fuß auf, um für einige Stunden die Nase in eine Neunkirchener, Dauner, Gemündener oder Oberstadtfelder Gastwirtschaft zu stecken. Immer mit Gesang, oft auch mit Hermanns Musikbegleitung, war selbst der Hin- und Rückweg eine sinnvoll genutzte Zeit. Auch die sonntagnachmittäglichen Spaziergänge niemand hätte damals an den Begriff des »Volkswanderns« gedacht durch Wald und Feld standen hoch im Kurs bei den Jugendlichen, als Mofas, Mopeds und Autos noch nicht zum Einzelgängertum verleitet hatten.

Unterhaltung wurde den jungen Dörflern damals noch nicht in ue, Heutigen verwirrenden Fülle geboten. Doch verstand man es recht gut, sie sich selbst auf herzerfrischende Weise zu verschaffen.
Unaufhaltsam aber hielt die neue Zeit ihren Einzug auch in mein Dorf im Tal des Pützbaches. Es änderte sich das Gesicht des Dorfes, es änderten sich die Ziele seiner Bewohner und die Menschen selbst. Wenn früher noch der kleine Laden von »Weiler Bäb« als Fundgrube für alle Dinge des bescheidenen täglichen Bedarfs ausreichte, so nahm bald ein Supermarkt diesen Platz ein und befriedigte auf verlockende Art die immer weiter steigenden Ansprüche. Grauschwarzer Asphalt hat Staub und Steine aus Jugendtagen für alle Zeiten unter sich begraben. Der von ungezählten Generationen genutzte Dorfplatz ist zu einer mit vorfahrtregelnden Schildern ausgestatteten, innerörtlichen Straßenkreuzung geworden. Er wird von dem wohlstandverkündenden Gemeindehaus beherrscht, das an Stelle des alten Schulgartens getreten ist, vor dem zwischen Bäumen »die Bank« zum Zusammensein einlud. Verstummt ist auch das vielstimmige Kinderrufen, das allmorgendlich und mittags vom Schulhof herüberdrang. Es gibt den Lehrer nicht mehr, vor dem man sich respektvoll hinter Mauerecken verdrückte, wenn er sich auf dem Weg durchs Dorf befand, und demman sich außerschulisch nur an dessen Namenstagen bei einem abendlichen Ständchen zu nähern wagte. Der Pützbach, früher ein Lieblingsaufenthalt der Dorfkinder, ihr »Schwimmbad« und »Anglerparadies«, schlängelt sich nicht mehr nach Belieben in zahlreichen Windungen am Dorf vorbei, sondern ist von allem unnötigen Gestrüpp befreit und in ein gemachtes Bett gezwungen. Mein Dorf hat die markantesten Züge seines Wesens dem Fortschritt geopfert: die mitmenschliche Nähe und die Nähe der Natur.
Was aber hat es dagegen eingetauscht? Ohne Zweifel den Menschen im kleinen Dorf, das sich heute »Stadtteil« nennt, geht es wirtschaftlich gut. Die Häuser sind schmuck verputzt, die Misthaufen verschwunden, die Hofflächen säuberlich aufgeräumt, die vor den Häusern geparkten Autos zeugen von Wohlstand und Aufgeschlossenheit. All dies sei ihnen von Herzen vergönnt! War aber der Preis, zu dem man diesen Errungenschaften Einlaß gewährte, nicht letztlich doch sehr hoch?
Die heutige Jugend, die damit heranwächst, wird nichts vermissen. Die Generation davor aber denkt oft noch gerne auch an »ärmere« Zeiten zurück, als sie sich in ihrem kleinen »Nest« geborgen wußte. Und fragt man mich heute nach meiner Herkunft, so ergötze ich mich regelmäßig an den neidvollen Blicken so manchen Städters, wenn ich ihm mein Dorf nennen darf. Selbst das Buchstabieren seines Namens und die Beschreibung seiner Lage bereitet mir Genuß. So ändern sich die Zeiten und die Menschen!