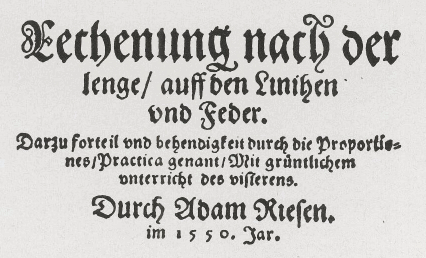
Die Volksschule
zur Zeit derKurfürsten
Alois Mayer
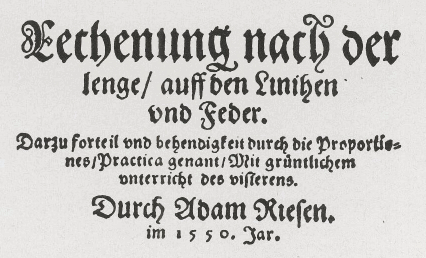

Adam Riese, Rechenung . . . Leipzig. 1550
Kreis Daun II. Teil
Der Volksschullehrer vom Pfarrer angestellt
Die Volksschule vor dem 18. Jahrhundert war eine Pfarrschule. Gefordert und gefördert durch den jeweiligen Landesherren, hauptsächlich aber durch die bischöfliche Behörde unter der Zuständigkeit und Obhut des jeweiligen Pfarrers. Dieser war schon von allein darauf bedacht, daß er Lehrer einstellen konnte, die im Interesse des Pfarrers Unterricht erteilten, ohne ihm irgendwelche Schwierigkeiten zu machen. Dabei kam es bei der Anstellung nicht so sehr darauf an, ob der Lehrer viel wußte, ob er pädagogische Fähigkeiten besaß und den Kindern gegenüber ein guter Erzieher war, sondern von größerer Wichtigkeit war, ob er das Wohlwollen des Pfarrers oder das der Gemeinde besaß. Ein wichtiger Gesichtspunkt in der Wahl des Lehrers war, daß dieser die Gemeinde nicht viel kostete. Manch einer wurde Schulmeister, bloß weil er versprach, der Gemeinde im Anschluß an seine Wahl Wein auszugeben, oder weil er öffentlich versicherte, die Witwe seines Vorgängers oder dessen Tochter zu ehelichen. Ein Kandidat wurde Lehrer, weil er laut vor dem Pfarrhaus verkündete, er werde noch nebenbei das Gemeindevieh hüten. Mancher war jahrelang als Ludimagister = Schulmeister angestellt, weil er dem Pfarrer nachweisen konnte, daß er das Tridentinische Glaubensbekenntnis kannte und sich »eines frommen belobten Wandels, ehrbarer Sitten, auch seines Wohlverhaltens glaubwürdigen Beweisthumbs« befleißigte.
Da man aber erkannte, daß dies alles, so gut, nützlich und katholisch dies auch sein mochte, dennoch zu wenig für die Erziehung von Kindern und Jugendlichen war, verlagerte sich das Recht der Lehreranstellung immer mehr auf ranghöhere Behörden, erst auf den Landde-chanten und später auf die Erzbischöfliche Behörde in Trier, die dann die Kandidaten auf ihr Können und Wissen hin prüfte und mit einem Zertifikat versehen, anstellte.
War eine Pfarrschulstelle besser besoldet als die andere, meldeten sich oft mehrere Kandidaten für diese Schulstelle, die der örtliche Pfarrer dann im Beisein der Gemeinde oder von Gemeindevertretern überprüfte. (1743 wurden dem Pfarrer von Mürlenbach z. B. drei Kandidaten, 1749 dem Pfarrer von Uersfeld ebenfalls drei Anwärter zur Auswahl vorgeschlagen).
»Eine Stimme wie ein blockend Kalb«
Wie eine solche Prüfung ausgesehen hat, schil-de.1 ein Prüfungsprotokoll aus dem Jahre 1729. Der alte Schulmeister war verstorben und um seine Nachfolge bemühten sich fünf Kandidaten. Die Stelle war sicherlich lohnend, denn mit der Lehrerstelle war noch das Amt des Küsters und Vorsängers verbunden, dessen Einnahmen das ansonsten armselige Lehrergehalt aufbesserten. Daher fand der erste Teil der Prüfung, die »Singprobe«, auch »in der Kirch vor Augen und Ohren der gantzen Gemeinde« statt, die vorher zusammen mit dem Pfarrer eine Betstunde in der Kirche abgehalten hatte mit der »herzlichen Erbittungh göttlicher Gnade« für eine gerechte Wahl.
Beworben hatten sich der 30jährige Schuhmacher Martin Ott, der Weber Jakob Maehl, »hat die 50 Jahre hinter sich«, der Schneider Philipp Hopp, »ein alter und gebrechlicher Mann mit 60 Lebensjahren«, der 50jährige Kesselflicker Johann Schutt und der Unteroffizier Friedrich Loth, 45 Jahre alt, der im Feldzug gegen die Schweden ein Bein verloren hatte.
Der Schuhmacher sang die Lieder »Christi lag in Todesbangen« und »Jesu meine Zuversicht«. Das Urteil der zuhörenden Gemeinde lautete, daß »er noch viel Melodie zu lernen hat und seine Stimme könnte besser sein.«
Der Weber Maehl sang drei Lieder, jedoch auch bei ihm ging »die Melodie ab in viele andere Lieder, aber auch die Stimm sollte stärker sein, er quieckte mehrmahlen, so doch nit sein muß.« Der Unteroffizier sang »Allein Gott in der Höh sei Ehr« mit guter starker Stimme, doch fehlt die Melodie im Ganzen, fiel einmal in ein ander Lied.«

Inneres einer Schule. Die Knaben sitzen bzw. stehen in einzelnen Gruppen in demselben Raum zusammen und erhalten Unterricht im Lesen, Singen und Rechnen. Auf der linken Seite eine Züchtigungsszene. Holzschnitt. Potsdam 1592
Am besten schnitt der Kesselflicker ab, der drei Lieder sang und dafür ziemlich viel Beifall der Gemeinde erhielt.
Vernichtend war aber das Urteil über den Schneider Hopp. »Er sollte lieber zu Hause geblieben sein, als sich dies zu vermessen. Hat zwei Lieder gesungen. Stimme wie ein blockend Kalb, auch oft in unrechte Lieder verfallen.«
Im Anschluß an die Singprobe wurden die Kandidaten ins Pfarrhaus gebeten, wo sie weiter geprüft wurden, diesmal unter Ausschluß der Öffentlichkeit. Dort schnitt der alte Schneider am schlechtesten ab. Er las aus der Hl. Schrift Joh. 19, 7-10 »jämmerlich«, buchstabierte Joh. 18, 22 - 23 »mit vielem Anstoßen: das große T ein Stein des Anlaufens, endlich drüber. Drey Fragen auß dem Verstand, blieb fast sitzen. Dreierlei Handschriften gelesen, sagte schon anfangs, daß er nit erfahren sey, drey Wörter geschrieben, mit Mühe zu lesen. Rechnen ganz unbekannt, zählte an den Fingern wie ein klein Kind. Wurde ihm fürgehalten, daß er töricht gewesen, sich zu melden, was er auch mit Thrä-nen und Seufzen bekennet.«
Ebenfalls abgelehnt wurde der Kesselflicker, obwohl er beim Singen als bester viel Beifall erhalten hatte, auch war sein Lesen und Buchstabieren von Gen. 4, 13 - 18 »nit uneben«. Entschuldigt hätte man bei ihm eventuell auch noch, »daß man beim Catechismo bemerkte, daß er in sothanen Stücken noch nit geübt sey, drey diktierte Reihen geschrieben, ging an, im Buchstabieren aber 10 Fehler, des Rechnens im Addiren erfahren«, jedoch ist bei ihm vermerkt und dies macht uns seine Ablehnung klar, daß ihm »nit zu trauen« sei, »sintemalen er viel durch die Lande streiche.«
»Nit trauen« konnte man auch dem Unteroffizier, obwohl er bei der Prüfung einigermaßen gut abschnitt. »Dreierlei handschriften fertig gelesen. Gelesen und buchstabiret Genesis 10,13 -18, ging ziemlich; hat den Catechismo wohl inne; vier Fragen aus dem Verstande ziemlich: dictando drei Reihen, jedoch mit acht Fehlern. Rechnen: Addiren und ein bischen Subtrahiren inne«. Dennoch mißtraute man dem alten Haudegen und lehnte ihn ab, weil er »wohl die Fuchtel gegent die armen Kindlein zu stark zu gebrauchen im Verdacht stehe.«
Der Weber Jakob Maehl hat Josua 18 mit zehn Fehlern gelesen, aber fehlerlos buchstabiert, dreierlei Handschriften las er schwach und mit Stocken. Die drei Fragen aus dem Verstand beantwortete er befriedigend. Die zehn Gebote und die 41. Frage im Catechismo sagte er fehlerfrei auf, schrieb aber in drei diktierten Reihen fünf Fehler und konnte ebenfalls nicht rechnen. Nicht viel besser war Schuhmacher Ott, der einigermaßen las, mit zwei Fehlern buchstabierte, mittelmäßig drei Handschriften las, die drei Fragen aus dem Verstand recht ordentlich beantwortete, aus dem Katechismus vom letzten Abendmahl und Frage 54 ohne Fehler aufsagte, drei Reihen Diktat mit vier Fehlern schrieb und im Rechnen durchaus unerfahren war.
Im Anschluß an die Prüfung stimmte der Pfarrer mit seinem »Prüfungsausschuß« ab, und die Wahl fiel auf den Schuster Martin Ott (vielleicht, weil er der jüngste war). Man ermahnte ihn, er solle dafür sorgen, daß die Lücken in seinen Kenntnissen schnell geschlossen würden und teilte das Ergebnis der Gemeinde mit, und »bey herzlichem Segenswunsche des Pastors mit dessen und der gantzen Gemeinde Befriedigung auff beiderseitiger Einigkeit solcher Bericht verfasset undt unterschrieben.«

Lehrer und Schüler. Im Hintergrund steht ein Schüler mit aufgesetztem Eselskopf. Holzschnitt. 1479
Ein Vertrag aus MeisburgWar nun damals der Lehrer durch Pfarrer und Gemeinde angestellt, wurden mancherorts Verträge aufgesetzt, die genau beschrieben, welche Aufgaben der neue Schulmeister in seiner Pfarrschule zu erledigen und welche Verdienste er dafür zu erhalten hatte. Dieser Vertrag konnte dann z. B. so aussehen, wie dies eine Meisbur-ger Urkunde aus dem Jahre 1782 bezeugt:
»Heut zu dem unten gesetzten Dato bekenne ich unterschriebener Wilh. Lehnen, früher alt gewesener Köster und Schullehrer zu Meisburg, daß ich mit Schuldes, Bürgermeister und Vorsteher einig geworden, daß ich von Allerheiligen Schul auf halde bis Ostern um den Lohn wie folgt örtlich von jedem Haus ein St. Thomaser Lither Korn so ungefähr ausmacht 16 Lither. Zweitens von jedem Kind 12 Albus an Geld, so jetzt dieses macht 6 Rthlr. So nehm ich oben gemeldeter Schullehrer diese Schul auf Lebzeit an vor den alten Lohn. Hergegen bin ich dausend-fältig dankbar, wenn etwas freiwillig aus Chur-fürstlichen Gnaden dargereicht wird. Geschehen Meisburg, den 14ten October 1782. W. Lehnen Schullehrer, H. Blonzen Schuldes, Jakob Weiler Vorsteher, Jos. Zirwes Bürgermeister, Wilh. Weber Vorsteher.« (aus: »Meisburg«)
»Im Sommer Lehrer, im Winter Maurer!«
Dieses Volkswort unserer Vorfahren sollte ausdrücken, daß die Arbeitszeit eines Lehrers recht kurz war. Im Sommer hatte der Lehrer frei und im Winterhalbjahr brauchte der Maurer nicht zu arbeiten. Doch sicherlich in Vergessenheit geraten ist der Ursprung dieses Necksatzes, nämlich, daß vor 200 und 100 Jahren die damalige Volksschule sehen wir von größeren Städten ab auch im Kreise Daun nur während des Winterhalbjahres betrieben wurde. Während des Sommers gab es keine Schule. Infolgedessen nannte man diese Schulform auch offiziell »Winterschule« und den darin unterrichtenden Lehrer »Winterlehrer«.

Der Schulmeister. Regensburg 1698.
Der Beginn der sogenannten Winterschule war verschieden, in manchen Orten am Feste des hl. Michael oder zu Allerheiligen, meistens jedoch am 11. 11., dem Fest St. Martin. Dieser Tag hatte im Leben des Eifelbauern eine weitaus größere Bedeutung als heute. Es war der Stichtag, an dem alle Abgabenpflichtigen aufgerufen waren, ihren Zehnten oder sonstige Schulden zu begleichen.
Ende des Schuljahres war fast überall am Gertrudistag (17. 3.), sobald die Witterung so günstig war, daß der Bauer pflügen konnte. Dann besuchte kein schulpflichtiges Kind zwischen 7 und 11 Jahren mehr die Schule, dann wurde den Sommer über kein Buch mehr zur Hand geholt, ja selbst die sonntägliche Christenlehre fiel meist zur großen Besorgnis des Pfarrers aus. Die besten und billigsten Knechte und Mägde waren für den Eifelbauern die Kinder, je mehr er deren hatte, desto günstiger wirkte sich der Kindersegen in der Unterstützung der harten täglichen Feldarbeit und in der späteren Altersversorgung aus. »Erst das Rind, dann das Kind«, so beklagten Pfarrer, Schulvisitatoren und Lehrer den traurigen Zustand, Den ganzen Sommer hindurch, an Sonn- und Feiertagen hüteten die Kinder das Vieh und vergaßen darüber das Wenige, das ihnen während der Winterzeit beigebracht worden war.
Mögen die Verantwortlichen auch inständig an die Vernunft appelliert und die Eltern zu Strafen verurteilt haben, die Einführung eines ganzjährigen Schulunterrichts scheiterte an der Armut und an der Uneinsichtigkeit der Bevölkerung. Viele Eltern hungerten daheim, um ihren Kindern zur Schule ein Stück Brot mitgeben zu können.
So schreibt der damalige Amtmann von Daun auch, um Verständnis für die bittere Armut bei der ständig wachsenden Bevölkerung bittend: »Die Amtsunterthanen beschweren sich insgesamt, daß die Schul ein ganzes Jahr aufgehalten werden solle. Sie behaupten, daß es durchaus eine bloße Unmöglichkeit seye. Das Vorgehen der Amtsuntherthanen scheint auch wirklich sogeartet zu seyn, daß es einige Rücksicht verdient, denn bekanntlich füret der Eifeler Bauer einen schweren Pflug, und die mehresten sind nicht so bemittelt, daß sie Gesind halten können. Ein Bauersknab von 8 - 9 Jahren muß schon das Vieh hüten und kaum hat er das 12. Jar erreicht, so ist er schon dem Vater eine unentbehrliche Hülf zum Ackerbau. Wie würde also der arme Unterthan bestehen, seine höchstbedürftige Nahrung herbeiholen und die Landessteuern entrichten können, wan ihm schon gleich anfangs die hilf seiner Kinder benommen wäre?«
Stundenlange Schulwege
Der Schulbesuch war mangelhaft. Es waren zwar alle Kinder zwischen 7 und 11 Jahren (in manchen Orten des Nordkreises Daun auch bis zum 12. Lebensjahr) schulpflichtig, dennoch blieben oft die Hälfte der Kinder dem Schulbesuch fern. Bedenken muß man dabei auch die äußerst weiten Schulwege zu den Pfarrorten, denn in den wenigsten Orten bestanden Filialschulen, für deren Unterhalt sowie für die Besoldung des Lehrers dann das Dorf aufzukommen hatte. So mußten die Kinder von Üdersdorf, Boverath, Rengen und Hörscheid nach Daun; die von Wallenborn, Michelbach, Büscheich, Gees, Pelm, Bewingen, Dohm und Lammersdorf nach Gerolstein; die Kinder von Arbach, Oberelz, Bereborn, Kolverath, Lirstal nach Retterath usw. Entfernungen von oft über 10 km zur Schule und spätnachmittags die gleiche Strecke zurück. Die Wege in schlechtem Zustand und ohne Beleuchtung, während des Winters in völliger Dunkelheit, naß, matschig, oft von hohem Schnee bedeckt und voller Gefahren. Unter Lissendorf ist zu lesen, daß die Kinder im Sommer wegen Viehhütens und im Winter wegen fehlender oder unzureichender Kleidung fehlten.
Die Pfarrvisitationsprotokolle sind immer wieder voller Klagen über den mangelhaften Schulbesuch und den uneinsichtigen Willen der Eltern. Strafen wurden angekündigt, von der Kanzel verlesen, durchgeführt; jedoch waren dies Maßnahmen, die nur selten zum Erfolg führten. 1712 ordnete Erzbischof Carl Josef an, daß alle Pastoren jeden zweiten Monat eine Versäumnisliste an die Landesdechanten schicken sollten, die dann ihrerseits das zuständige Offizialat zu informieren hatten. Dies geschah aber nicht.
Wachs als Zuchtmittel
1744 ordnete der Dechant für Rockeskyll an, daß diejenigen, die die Winterschule nicht besuchten und die Christenlehre versäumten für einmaliges Fehlen mit 1/4 Pfund Wachs, für zweimaliges Fehlen mit 1/2 Pfund Wachs und beim dritten Male mit einem Pfund Wachs zu bestrafen seien. Die Schöffen sollten darüberwachen, wer sich weigerte, die Strafe zu zahlen, war der weltlichen Obrigkeit zu melden.
Strafen und Strafandrohungen erfolgten fast in allen Orten, so auch in Salm, da »den Eltern das Vieh mehr wert ist als die Seele des Kindes, die durch Christi Blut erlöst ist.« 1/2 Pf und Wachs kostete das Fehlen in der Schule von Uersfeld. Selbst unter Strafandrohung war der Schulbesuch in Daun schlecht, obwohl der Lehrer 1719 sich bereiterklärt hatte, die armen Kinder gratis zu unterrichten.

Satirische Darstellung einer Schulszene. Nach P. Breughel d. Ä. 1557. München
Viele Eltern und Filialorte ergriffen trotz ihrer persönlichen Armut dennoch die Initiative, gründeten und richteten Nebenschulen ein, die sogenannten Filialschulen, damit ihren Kindern
dadurch der weite Weg zum Pfarrort erspart blieb, zumal sonntags viele oft zweimal den Weg gehen mußten, morgens zur Messe und nachmittags zur Christenlehre! Glaubt man nun, daß dieses Engagement der Eltern belohnt worden wäre, so irrt man sich, denn man war damals dem Existieren von Filialschulen gegenüber nicht besonders positiv eingestellt. Allzuoft hatte man Angst, diese Schulform könnte sich zu sehr verselbständigen und sich so dem Einflußbereich des Pfarrers entziehen. Stellenweise war man tatsächlich der Ansicht, das Bestehen solcher Filialschulen sei ungesetzlich, da sie auch das Ansehen und den Verdienst der Mutterschule (= Pfarrschule) und deren Lehrer schmälere.Verständlich ist auch die Ablehnung vieler Pfarrer, wenn man bedenkt, daß diese ja verpflichtet waren, in regelmäßigen Zeitabständen die Schule zu visitieren, eine Aufgabe, der viele Pfarrherren nicht gerne nachkamen, besonders wenn sie nun ihrerseits zu Fuß vom Pfarrort zur Filiale gehen mußten.
So behauptete der Pfarrer von Walsdorf im Jahre 1719, seine Pfarrschule sei in Ordnung, ein guter Lehrer sei vorhanden, der als Schulbücher das Evangelium und das Alte Testament benutze. Als der Visitator im gleichen Jahre Walsdorf besuchte, stellte er erstaunt fest, daß weder Schule noch Lehrer vorhanden waren und ordnete an, daß wenigstens der Küster und sei es auch nur für ein Jahr, unterrichtender Lehrer sein sollte.
Wegen des weiten Weges von Scheuern nach Roth dingten sich die Scheuerner selbst einen Winterlehrer. Der Visitator verbot dies 1753 jedoch und befahl, daß wieder alle Kinder nach Roth kommen mußten, damit dort ein geordneter Schulbetrieb herrsche. 1761 schaffte sich die Gemeinde Gelenberg einen Lehrer an, da der Weg von 16 km hin und zurück zur Kelberger Schule für die Kinder zu weit war. Allerdings taten sie dies gegen den Willen des Kelberger Pastors, der die Gemeinde Gelenberg darauf hin beim Landdechant Lei-ver verklagte. Dieser bestrafte auch alle Einwohner Gelenbergs wegen Halsstarrigkeit mit 1/2 Pfund Wachs. 1770 protestierten die Einwohner erneut gegen den unzumutbaren Schulweg, doch erst in preußischer Zeit bekamen sie Recht. 1770 protestierten die Eltern von Rothenbach und Meisenthal mit Erfolg wegen des weiten Schulweges nach Müllenbach.
Früher Trend zur Dorfschule
Um den Meinungsstreit zu beenden, beauftragte Erzbischof Clemens Wenzeslaus seine Visi-tatoren zu prüfen, ob die Filialschulen weiter bestehen sollten. Der Aufsichtsführende, Hoener, sprach sich ebenso wie seine anderen Kollegen für den weiteren Erhalt aus. Er schrieb, daß es aus gesundheitlichen Gründen für die Kinder sehr schädlich sei, diese gerade in den gebirgigen Teilen des Erzbistums zur Pfarrschule kommen zu lassen.
»Diemehresten Filialen seyen eine auch viele zwo Stunden, besonders in der Eifel, doch wenigstens eine halbe Stunde von der Mutterschule entlegen, die Berge hoch und jäh, die Thäler tief und sumpflicht. Welcher Menschenfreund würde die Kinder die mit Eise bedeckten Berge oder die mit Schnee und Wasser oft knie-oder brusthoch angefüllten Thäler wandern lassen? Wie viele Bäche wären in diesen Gegenden, die oft so anschwöllen, dass man ohne Lebensgefahr sich durch dieselben nicht wagen dürfte!« Hinzu komme, daß die Kinder oft sehr schlecht und armselig gekleidet seien. Ferner berichtete er noch, daß viele Kinder aufgrund der schlechten Ernährungslage auch unterernährt und zu schwach seien, ständig diese weiten Schulwege zu gehen. Viele Schüler hätten zudem kein Mittagessen, auch sei die Mutterschule viel zu klein, um allen Platz zu gewähren, wenn die Filialkinder hinzu kämen.
Vorgekommen ist es sogar, daß eine Gemeinde, auch wenn sie selbst für den Unterhalt eines »Hilfslehrers« sorgte, dennoch gleichzeitig für den fest angestellten Lehrer am Pfarrort mitsorgen mußte. So war z. B. die eigentliche Schule für die Kinder aus Weidenbach in Deudesfeld. Wegen des beschwerlichen Weges leisteten sich die Weidenbacher einen »Hilfslehrer«, sollten aber auch mitaufkommen für den Deudesfelder Lehrer. Als sie sich weigerten, drohte man ihnen den »Filiallehrer« fortzunehmen.
Der Unterricht vor 200 Jahren
Damals bestand die Aufgabe des Lehrers hauptsächlich darin, den Kindern Lesen, Rechnen und Schreiben beizubringen und sie den Katechismus auswendig lernen zu lassen. Das hört sich flüchtig gelesen recht einfach an, doch vergegenwärtigen wir uns der Zeit vor rund 200 Jahren: Es gab noch keine psychologisch durchdachte, kindgemäße, didaktisch aufgebaute Lehr- und Lernmethode. Der Lehrer, der den Sommer über irgendein Handwerk ausübte (Schumacher, Weber, Hirte, Scherenschleifer. . .) stellte sich vor die Klasse, in der Kinder zwischen 7 und 11 oder 12 Jahren auf primitiven Bänken oder sogar auf dem Fußboden saßen und versuchte ihnen »etwas beizubringen«.
Lehrbücher gab es keine. Schiefertafeln und Griffel waren keine vorhanden und Papier war so teuer, daß es unerschwinglich war. So lernte der größte Teil der Mädchen überhaupt nicht schreiben und die Jungen nur, wenn deren Eltern es ausdrücklich wünschten und somit auch für den Schreibunterricht aufkamen. Rechnen war in den Schulen des damaligen Kreises Daun nirgendwo eingeführt. Eine Schulfibel, aus der man hätte lesen oder lernen können, war nicht vorhanden.
So bestand der Unterricht hauptsächlich im Lesen, das nach der Buchstabiermethode eingeführt wurde. Als Hilfsmittel dazu dienten der Katechismus von Scouville oder andere religiöseBücher. Da die Anzahl der Schüler zu groß und die Gruppen zu ungleichartig waren, befaßte sich der Lehrer hauptsächlich mit dem einzelnen Schüler. Im Katechismusunterricht wurde nicht auf den Inhalt der Glaubensaussagen eingegangen, sondern es wurde einfach auswendiggelernt. Meist waren es die Paragraphen und Kapitel, die der Pastor sonntags vorher in der Kirche durchgenommen hatte.
Grundsätzlich oblag der Religionsunterricht den Geistlichen, die aber regelmäßig bei ihrer Behörde oder dem von ihnen angestellten Lehrer darauf drängten, daß auch der Lehrer dieses Fach unterrichten sollte. Forderungen wie, der Lehrer »soll in allen Schulen deß sambstags anderß nichts als die Christliche lehr oder Catechismus den Kindern vortragen und explicieiren« oder »des Samstagnachmittags den Katechismus vorlesen und aus ihm prüfend die Kinder unterrichten« wurden häufig gestellt.
Es wurde ferner vom Lehrer verlangt, daß er die Schüler täglich in ordentlicher Art und Weise zum Gottesdienst führte, dort Aufsicht hielt und für Ordnung und Disziplin sorgte, zu Beginn und Ende des Unterrichts ein Gebet sprach und vor allem darauf achtete, daß die Verehrung Gottes, der Gehorsam den Eltern gegenüber sowie die Ehrfurcht vor den geistlichen und weltlichen Oberen nicht zu kurz kamen. Des weiteren sollte er seine Sorgfalt darauf verwenden, daß die Kinder wenigstens viermal im Jahr zur Beichte gingen. Oft waren ihm noch weitere Aufgaben zugedacht, wie Vorsingen in der Kirche, »Orgelschlagen« oder eine Art von »Polizeifunktion«, um Ordnung auch innerhalb des Dorfes zu halten. Dementsprechend war auch der Ausbildungsstand der Schüler, der bei Visitationen festgestellt und ins Protokoll aufgenommen wurde. Oft ist wohl vermerkt, daß die Schüler »gut« dem Prüfer antworteten, wobei sich die gestellten Fragen aber hauptsächlich auf den auswendiggelernten Katechismus bezogen.
So konnten z. B. 1780 im Dekanate Kyllburg, zu dem die Orte Bleckhausen, Deudesfeld mit Weidenbach, Meisburg, Densborn, Niederstadtfeld mit Schutz, Salm, Mürlenbach mit Birresborn, Kopp, Lissingen und Hinterhausen, Duppach, Oos und Reuth gehörten, von 1 434 Kindern in 42 Schulen nur 158 Knaben und 25 Mädchen schreiben; in keiner Schule wurde gerechnet. Bibelkenntnisse und Katechismus waren jedoch überall sehr gut. Diese katastrophale Bildungsenge war aber nicht nur auf den Kreis Daun oder die Eifel beschränkt, sondern war damals eine allgemeine Erscheinung in allen deutschen Landen (vermutlich sogar in Europa. Es liegen z. B. Aussagen von Franzosen vor, die nach der Besetzung unseres Raumes nach 1794 den Bildungsstand der Eifeler als weit höher bezeichneten als den der Franzosen.)
Landdechant Schmid, der als Schulvisitator Ahnung von dem damaligen Wissen und Können Eitler Schulkinder hatte, schrieb dem Trierer Kurfürsten am 25. 8. 1793: »Ehedem, da noch nicht solche gemeinnützige Anstalten (Lehrerseminare) existierten, war man bemüsiget, Schullehrer anzunehmen, die aufs höchste bey der Untersuchung aus dem Catechismo einige leichte Fragen beantworten konnten. Ihre ganze Kunst, zu catechisieren, bestand darinnen, durch Fragen zu erfahren, was die Kinder im Gedächtnis hatten. Daher kommt es denn auch, daß die meisten Katolischen nicht lesen können und keine Lust dazu bezeigen, weil ihnen das zu beschwerlich fällt. Es kommen oft in der Reihe Wörter vor, die sie nicht lesen können ohne sie buchstabieren zu müssen, und das sind sie nicht recht gelehret worden. Man hat sich demnach nicht zu wundern, wenn man keine Erbauungsbücher antrifft, womit sie sich sonn- und feiertags nützlich die Zeit vertreiben könnten, welches dann also in Wirtshäusern . . . geschieht.«
»Noch seltener war auf dem Land die Schreibkunst; gegen diese waren die Schullehrer gleichgültig: Die Schüler wurden zum Schreibenlernen nicht angehalten. Die alten Schuldiener schreiben selbst eine schlechte Hand; kalligraphische und ortographische Regeln waren ihnen spanische Dörfer. In der alten Schule hatte es einer weit gebracht, wenn er seinen Vor-und Zunamen kritzeln konnte, den ein Unbekannter oft gar nicht herausbringen konnte, geschweige, daß man imstande war, eine Bescheinigung oder Quittung oder ein Billet zu Schreiben. In betreffs der Weibsperson aber hegte man durchgehends das Vorurteil, daß die Schreibkunst ihnen nicht nöthig oder gar gefährlieh sey. Was endlich die Rechenkunst anbelangt, so war sie in unseren Schulen so fremd, daß man nicht imstande war, ein Lied im Gesangbuch nach den Ziffern aufzusuchen.«
»... das arme Dorfschulmeisterlein»
Heute lacht man über das heitere Liedchen. Damals war sein Inhalt bittere, teilweise sogar grausame Wirklichkeit. Der Lehrer war arm, oft »nagte er am Hungertuche«. Ein Staatsgehalt gab es nicht. Die Besoldung, die von Ort zu Ort verschieden war, bestand meist aus Naturalien oder Schulgeld. Schulgeld hatten die Eltern aufzubringen. Da dies aber viele Eltern nicht konnten oder die Schülerzahl zu gering war, mußten kraft pastoraler und behördlicher Anordnungen Familien, die keine Kinder hatten, ebenso Schulgeld zahlen oder sonstige Abgaben tätigen.
1779 haben im Amte Daun daher die Einwohner »in den Ortschaften der Nebenschulen einhellig erkläret, daß man dem Schullehrer ehender die freie Beköstigung täglich, als die statt derselben angesetzten zwei Reichstaler geben könnte.«
Damit ist der sog. »Wandeltisch« angesprochen. Der Lehrer wurde meist in den Familien mit schulpflichtigen Kindern beköstigt. Täglich in anderen Orten gab es auch zeitlich andere Regeln ging er in ein anderes Haus und erhielt dort freies Essen. Enttäuschend und erniedrigend war es oft, wenn er von Haus zu Haus zog und sein ihm zustehendes Schulgeld oder Naturalien (Hafer, Gerste, Spelz, Holz, Eier) forderte. Gleich einem Bettler wurde er behandelt. Unzufriedenheit, Zank, Streit, Mißgunst begegneten ihm. Was er erhielt, war oft schlechte Ware: Milch mit viel Wasser, schlechtes Holz, ohne viel Heizwert, Getreide minderer Qualität und mit Unkrautsamen durchsetzt. . .
Mancherorts war es üblich, dem Schullehrer am Neujahrstage pro Kind 3 Albus (Wert ca. 18 Pf) zu schenken. Doch viele Eltern schickten, um diesem Brauch zu entgehen, ihre Kinder erst einige Tage nach Neujahr zur Schule.
1744 wehrten sich die Waldköniger, dem Steinborner Lehrer, der zugleich Küster war, die zwei Ostereier, die ihm fürs Schulhalten zustanden, abzugeben, falls er ihnen am Palmsonntag nicht persönlich die geweihten Palmzweige vorbeibringe.
Mancher Viehhirte oder Küster war mitunter besser gestellt im Einkommen als der Winterlehrer. Damit er tatsächlich nicht verhungerte, war er auf andere Tätigkeiten angewiesen: Gemeindedienste, Fronarbeiten, teilweise Viehhüten, Küsterdienste, Orgelspielen. Glücklicher war der Lehrer dran, der Äcker, Felder und Vieh sein eigen nennen durfte.
1752 wurde für Uess angeordnet, daß jede Familie dem Lehrer jährlich ein Faß Korn geben mußte (ca. 33 Pfund).
1781 erhielt der Lehrer in: Birresborn (62 Kinder): 5 Rtlr. und die Kost. Mürlenbach (47 Kinder): 3 Malter Korn (ca. 12 Zentner). Niederstadtfeld (30 K.): 1 Malter 8 Sester Korn, sonst nichts.
Ürsfeld: 2 1/2 Rtlr. mit Kost. Beinhausen: 15 Rtlr. Brockscheid: 20 Rtlr. Daun: 35 Rtlr. Kelberg: 41 Rtlr. Mehren: 51 Rtlr. Nohn: 71 Rtlr. Oberehe: 20 Rtlr. Rockeskyll: 30 Rtlr. Schalkenmehren: 25 Rtlr. Steinborn: 18 Rtlr. Strohn: 26 Rtlr. Meisburg: 6 Rtlr. und 16 Liter Korn. Welcherath (14 Kinder): 6 Albus (pro Kind) Gefordert wurde im Jahre 1778 von dem Visitator Hoener, daß jeder Lehrer ein Mindestgehalt haben müsse, um einigermaßen menschengerecht existieren zu können. Für einen Lehrer, der im Ort eine Wohnung hat, 68 Rtlr., für einen auswärtigen Lehrer 100 Rtlr. und für Lehrer an Filialschulen 25 Rtlr.
Heilsame Stiftungen
Um die Not zu lindern, stifteten oft edle Seelen Felder, Wiesen oder Wälder oder auch Gelder, von deren Erlös oder Zinsen sowohl der Lehrer besoldet als auch Schulbücher angeschafft oder arme Kinder kostenlos unterrichtet werden sollten.
So machte 1786 Pfarrer Bürsgens aus Mehren in seinem Testament eine Stiftung von 564 Rtlr., deren Zinsen zur Unterstützung fleißiger Kinder, für Kostgeld, Kleider, Schreibutensilien usw. gedacht waren.
1777 machte der Notar und gewesene Schultheiß Matthias Meyer aus Walsdorf eine Schulstiftung für die Walsdorfer Schüler. Bereits 1694stiftete Pfarrer Cremer in Hillesheim 175 Taler, deren Zinsen von 8 Taler 41 Albus als Beitrag zum Lehrergehalt gedacht waren, welches zu dieser Zeit 19 Taler und 6 Albus ausmachte. Als Bedingung war an diese Stiftung geknüpft, daß der Lehrer dafür sieben Kinder kostenlos unterrichten mußte. (Das Schulgeld betrug damals in Hillesheim 4 Albus pro Monat und Kind). Am 11. 1. 1729 tätigte der Priester und spätere Professor Johann Leonhard Retz aus Bodenbach eine Studienstiftung von 700 Talern zur Unterstützung armer Studenten aus der Pfarrei Kelberg. Die Zinsen von 22% Talern sollten, solange kein Mitglied der Familie Retz studierte, dem Vikar von Bodenbach zugute kommen mit der Verpflichtung, an Sonn- und Feiertagen sowie täglich in der Schule Religionsunterricht zu erteilen.
In Niederstadtfeld stiftete Pfarrer Diedrich 1793 vier Taler als Rente zur Unterstützung armer Schulkinder. In Ürsfeld erhielt der Lehrer ab 1781 seitens der Kirche vier Taler, für die er arme Kinder kostenlos unterrichten mußte. 1782 stiftete Pfarrer Dreyser aus Welcherath ein Feld, dessen Erträge zur Hälfte als Schulgeld für arme Kinder dienten. 1726 stiftete Pfarrer Reiner Adriani in Niederehe der Schule 24 Rtlr. Früher als sonstwo ist in Esch die Rede von einem geordneten Schulbetrieb. Bereits 1631 stiftete Graf Johann Arnold von Manderscheid 143 Taler, für deren Ertrag der Kaplan die Pfarrschule halten sollte. Um 1700 wurden erneut 100Taler durch Pfarrer Peter Pfleumer zur Unterstützung des Magistrats gestiftet.

Titel eines Schönschreibheftes von dem Nürnberger Schreib- und Rechenmeister Johann Burger. 1677
In Daun stiftete 1719 Klara Hamann 100 Taler, aus deren Zinsen Kleidung für arme Schüler beschafft werden sollte. 1787 vermachte der Pfarrer Müller aus Nürburg testamentarisch der Schule in Nohn, seinem Geburtsort, 750 Taler mit der Verpflichtung, daß der Lehrer dafür täglich mit allen Schülern ein »Vater unser« und ein »Ave Maria« beten mußte.
Bei dieser prekären Situation der Lehrerbesoldung ist es zu verstehen und dem damaligen Schullehrer auch nicht zu verdenken, wenn er auf einer Hochzeit, zu der er gelegentlich eingeladen wurde, weil man ihn oft auch als Musikant oder Sänger anheuerte, sich ordentlich den Leib mit all den Genüssen vollschlug, auf die er ansonsten das ganze Jahr über verzichten mußte. »Und wenn im Dorf ne Hochzeit ist, dann könnt ihr sehen wie er frißt; was er nicht packt, das steckt er ein, . . . das arme Dorfschulmeisterlein«.
»Wer die Rute schonet, der hasset seinen Sohn!«
Uneinheitlich wie das gesamte Schulwesen war auch die Handhabung der Disziplin. Es ist davon auszugehen auch manch einem klingt es noch weh in den Ohren, wenn er seine Großeltern erzählen hört , daß bei der großen Anzahl der Schüler, der Uneinheitlichkeit des Lehrstoffes und der Lehrmethode, in der dumpfen Enge eines primitiven Schulsaales der Schulmeister sich nicht anders wehren und durchsetzen konnte als mit Schreien und Prügeln. Das Bild des schlagenden und strafenden Lehrers ist nicht neu. Es ist überall in Zeichnungen und Urkunden in der Griechen- und Römerzeit und durch das gesamte Mittelalter hindurch bis in die heutige Zeit zu finden. Der Lehrer, abgebildet mit Stock oder Reisigbündel, verkörpert Macht, Zucht und Ordnung. Die körperliche Züchtigung stellte für den Lehrer ein Erziehungsmittel dar, bei dem er sich mit Recht sowohl auf jahrhundertelange Tradition als auch auf die Bibel berufen konnte. ». . . ein solcher Vater soll wissen was der hl. Geist sagt: Strafe dein Kind mit der Rute, so wirst du dessen Seele von der Hölle erretten«. So rechtfertigte sich der Priesterlehrer J. J. Sikken aus Wollmerath, als er wegen übertriebener körperlicher Züchtigung eines Schülers verklagt worden war. Der Bibelspruch (Überschrift) ist allzuleicht mißverstanden und übertrieben worde.
In die »Eselsbank« verbannt
Jedoch muß leider gesagt werden, daß viel Brutalität und Rohheit in den damaligen Landschulen herrschte. Zwar gab es ständige Hinweise darauf, die Schüler nicht zu sehr zu schlagen. Es wurden Verfügungen erlassen, die Kinder nicht auf die Köpfe zu schlagen, auch nicht auf die Hände, sondern »in die hindern oder äffteren«, dies aber auch nicht mit Stöcken, sondern mit Ruten, die meist in der Form eines Besens gebunden waren. Die Knaben mußten zu dieser Prozedur sehr oft den hinteren Hosenboden öffnen, zumal die Pfiffigen ihr Sitzfleisch vorsorglich mit einem Polster absicherten. Als erzieherisch nachhaltig werteten viele Lehrer, die Schüler oder die Klasse in die Natur zu führen, um die Ruten selbst zu schneiden, weil dadurch straffällige Schüler bei passender oder auch willkürlicher Gelegenheit empfindliche Körperteile spürbar besser kennenlernten, natürlich auch die Wirksamkeit der Züchtigung.
In Visitationsberichten gaben mehrere Lehrer zu Protokoll: »Eine große straf ist Mit Einer Ruth 2 oder 3 Mahl auf den Rücken.« Weitere sehr häufige Strafen waren das Einsperren in dunkle Räume (in den Backes, in den Keller, in den Stall), »eine Kleine straf ist in die stub zu kniegen«, das Verbot, mittags sein Brot zu essen, zur Strafe auf andere Schüler aufzupassen. Über Jahrhunderte hielt sich auch die Gepflogenheit, schlechte Schüler ähnlich dem mittelalterlichen Zurschaustellen so zu bestrafen, daß sie einen Eselskopf überziehen oder wie ein Schandzeichen das Bild eines Esels auf einem Brettchen um den Hals tragen oder sich vorne in die erste Bank, die »Eselsbank« setzen mußten.
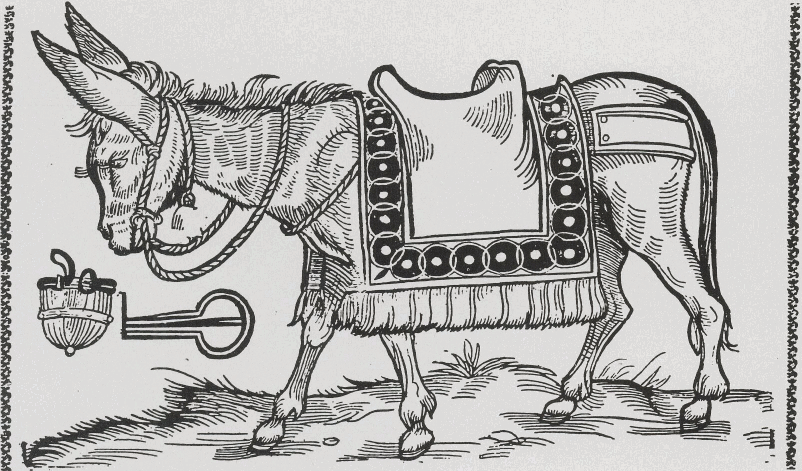
Im Germanischen Museum zu Nürnberg findet man ein Flugblatt mit dem Spottbild eines Esels zur Abschreckung für faule Kinder. Der Text lautet:
|
Wer faul zur Arbeit ist, |
|
ist einem Esel g/eich, |
|
der aber Tugend liebt, |
|
der wird an Ehren reich. |
|
Schaut hier ist der Eselmann, |
|
der die Ohren spitzen kan, |
|
kommt her, und sehet zu, |
|
er ist hurtig wie eine Kuh, |
|
wann man ihm gibt Butterweck, |
|
flieget er, gleich wie ein Schneck, |
|
sein Kopflist so Wohlgestalt, |
|
wie die Eule in dem Wald. |
|
Seine Ohren sind so klein, |
|
daß drein geht ein Eimer Wein, |
|
seine Augen sind so schärft, |
|
daß er hundert Brillen bedarff. |
|
Er ist ehe nicht gesund, |
|
bis das Futter hängt am Mund, |
|
Wunder dessen, wann er frist, |
|
drauff der Furtz sein Music ist. |
|
Dann die Trummel ist sein Freud. |
|
Futer-Sack der Seelen Weid,
|
|
Nimmer munder wird zu faul, |
|
legt man ihm den Zaum ins Maul, |
|
legt man auf ihn Last und Joch |
|
thut er dann kein gut annoch, |
|
muß man ihn mit Peitschen schlagen, |
|
und die Haut wie Stockfisch schlagen.
|
|
Eben also wann die Jugend, |
|
nicht will lernen Kunst und Tugend. |
|
Traget sie vor ihren Lohn, |
|
einen Eselskopf davon, |
|
vor den Heller und den Weck, |
|
kriegen sie die Ruth und Steck, |
|
vor die Ehre Schand und Spott, |
|
das es heist: Erbarm es Gott. |
Jedoch gab es auch fortschrittliche Lehrer, die als gute Pädagogen galten und statt Strafe ein Belohnungssystem anwandten, wie z. B. Verschenken von (Heiligen-) Bildchen, Geld, Nahrungsmitteln oder sonstigem. Beliebt war auch die »öffentliche« Belohnung in der Kirche vor der gesamten Gemeinde oder in der Schule, wenn man auf hintere Plätze aufrücken durfte, das Aufpassen gleich Lehrerspielen über schwächere Schüler, das Meßdienen oder das Erledigen von privaten Arbeiten für den Lehrer. (Fortsetzung im Jahrbuch 1983).