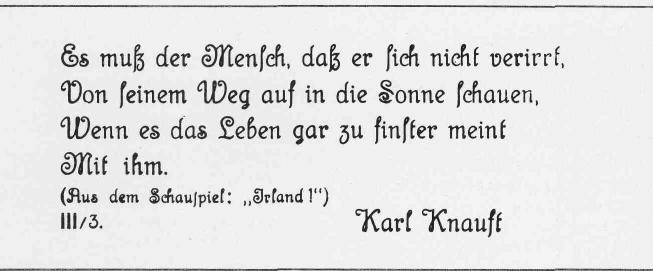Mater Eiflia
Erinnerung an Karl Knauft
Liselotte Dom
Es war in den endzwanziger Jahren unseres Jahrhunderts, die Narben des ersten Weltkrieges noch kaum verheilt. Hunger, Not und vor allem Arbeitslosigkeit überall. In den Großstädten war alles noch viel schlimmer als auf dem Land. Da beschloß der Berliner Karl Knauft, etwa 50jährig, Dichter von Beruf, seine Heimatstadt zu verlassen, um sich irgendwo auf dem Land anzusiedeln.
Auf dem Rückzug als Soldat des 1. Weltkrieges war er durch die Eifel gekommen. Diese Landschaft hatte es ihm angetan, er kam nicht von ihr los, und so lenkte er, wie von einem Magnet angezogen, mit seiner Familie die Schritte nach Westen und landete im kleinen Eifeldorf Berndorf, nicht weit von Burg Kerben, worin der große Eifeldichter Fritz v. Wille seinen Wohnsitz hatte. Seine Familie, das war seine viel jüngere Frau, sein 6jähriger Sohn Fridolin und sein 80 Jahre alter Vater. So schreibt Karl Knauft im Vorwort seines Büchleins »Mater Eiflia«: Alles in meinem Leben betrachte ich, mit Schopenhauer gesprochen, als eine dringende Notwendigkeit. So war es also eine Bestimmung des Schicksals, das immer Überraschungen für mich in Bereitschaft hält, daß ich meine Schritte nach der Eifel lenkte; der rauhen Eifel, wie man allgemein sagt, die ich aber gar nicht als so rauh empfunden habe, sondern deren Stille mir zur Labung wurde, die mich beglückte, die ich in der Erinnerung festhalte als Wegzehrung für mein ferneres Leben. Drum sage ich: Die stille Eifel! Ob die Tage trübe waren, ob die Wolken ihre Schleusen öffneten, ob Blitze flammten, ob Stürme über die kahlen Höhen jagten, ob sich die Schneeschanzen hoch vor niedrigen Hütten auftürmten Du, Mater Eiflia, warst immer schön, und wie schön warst Du, wenn die Sonne in Deine Talmulden lachte, und wenn blaufunkelnd des Nachts die Sterne in Deiner Einsamkeit mir erzählen und sagen wollen: »Du bist hier nicht fremd, Du bist in Deinem schönen, deutschen Vaterland!«

Karl Knauft wurde nicht enttäuscht. Hilfreiche Hände streckten sich aus, und so fand die Familie zweieinhalb Stübchen im Dachgeschoß eines ebenfalls sehr armen Schneiders. Karl Knauft schreibt über Berndorf so: Liegt auf der Höhe in einer Senkung zwischen Hillesheim und Kerpen. Ein Ober- und Unterdorf, plätschernde Brunnen, uralte Häuschen, zwei Kirchen im Oberdorf; die alte, schon um 1150 genannte, da oben auf dem Kirchberg und die neue da unten an der Straße, erst vor einigen Jahren erbaut. Die Wetterhähne auf den beiden Kirchen liegen in ewiger Fehde; zeigt der eine Nordwind an, schaut der andere da oben auf der alten Kirche vergnügt nach Westen oder umgekehrt, sie harmonieren nie miteinander! Oben,am Ausgang des Dorfes, das alte Pfarrhaus mit wuchtiger Scheune. Ein stiller, leidender Herr bewohnt es. Er wurde im Krieg schwer verwundet. Es kommt vor, daß er den Gottesdienst seiner großen Leiden wegen abkürzen muß, aber er versieht sein Amt mit großer Liebe und Treue, und die Berndorfer wissen das sehr zu würdigen.
Es schien, als öffnete sich den Knaufts nicht nur der karge Boden, nein auch die Herzen der an sich so verschlossenen Eifelbauern öffneten sich ihnen. Fridolin, der bisher in den düsteren Straßen Moabits gespielt, trieb nun mit den Berndorfer Jungen die Kühe auf die Weide, und so manches Butterbrot vom Bauern fiel für ihn ab. Und so kam es, daß Karl Knauft gute Freunde in Berndorf gewann. Anschließendes Gedicht aus »Mater Eiflia« soll dies bekunden:
Nagelschmied von BerndorfDer
Es war einmal ein Nagelschmied
im hohen Eilelland
Im Kylltal und um Hillesheim
wohl meilenweit bekannt.
Er pitscherte von morgens frü
hbis in die späte Nacht
Am Amboß Nägel groß und klein
Wie keiner je gemacht.
Und waren all die Säcklein voll,
nahm er den Rucksack her;
Zur Kundschaft gings bergauf bergab
Mit all der Last so schwer.
Froh lebte er von seiner Kunst
Wohl über 60 Jahr;
Heut ist die Zunft des Nagelschmieds
Schon lange nicht mehr wahr.
Sein Amboß steht vereinsamt da,
Die Hämmer drum und dran;
Der Nagelschmied ist längst ein Greis,
Der seine Pflicht getan.
Verweile ich bei ihm zu Gast,
Erstrahlt sein Augenpaar,
Wenn plötzlich er von Zeiten sprach,
Da er der Meister war.
Und als ich einst spät von ihm ging
Es klingt wie eine Mär
Holt er aus längst vergeß nem Sack
Mir einen Nagel her.
'Nen Nagel, den er selbst einst schlug.
'Nen Nagel, so alt wie ich
Von echtem Eifeleisen noch,
»Da den schlug ich für Dich!«
Mit diesen Worten legte er
Den Nagel vor mich hin
Ich griff danach und seitdem will
Mir eins nicht aus dem Sinn:
Halt ich den Nagel in der Hand,
Hör ich das Märchen vom Glück:
Ich seh den Amboß ich seh den Greis
Und seinen begeisterten Blick
Doch das so ersehnte Glück wollte sich bei Karl Knauft nicht einstellen. Er versuchte nun als Poet den Lebensunterhalt zu verdienen. Er gründete die Gemeinschaft deutscher Dichter und Denker und gab gleichzeitig eine Zeitschrift »Der Turmwart« heraus. So wurde die kleine Küche unterm Dach zur Schreib- und Verlegerstube. Der Küchenherd wärmte die kleine Familie. Karl Knauft schrieb Gedichte und versandte sie als Spruchkarten, doch davon konnte man nicht leben. So rissen die Sorgen ums tägliche Brot nicht ab. Andere Verdienstmöglichkeiten gabs rundum noch weniger als in Berlin. In dieser Zeit, etwa um 1930 begrub Karl Knauft seinen alten Vater. In Ermangelung eines Grabsteins, setzte er dem alten, Berliner Gastwirt einen Bierkrug aufs Grab. Etwas später schrieb Karl Knauft folgendes Gedicht:
Grab in der EifelDas
Dort, Vater, schläft's sich gut, da in den Bergen;
Ruhst Du auch fern von Deinen Lieben,
So bist Du, Vater,
dort wie hierzu Hause
Von allem ist mir dieser Trost geblieben.
Ruhst, Vater, Du auch nicht in Heimaterde,
So doch in Deinem Vaterlande;
Noch enger knüpfen sich in Deinem Tode
Mein guter Vater, zwischen uns die Bande.
Schmückt, Vater, noch kein Stein
jetzt Deinen Hügel;
Zwang ich so manches doch im Leben
Und zwing auch das noch, Vater!
Groß und golden
wird noch im Stein der Nachßwelt Kunde geben
Dein Name, Vater, wo Du ruhst
Karl Knauft war im Gegensatz zur katholischen Eitel evangelisch. Doch die Gläubigkeit dieser einfachen, bäuerlichen Menschen berauschten ihn, und er versuchte einzudringen in ihren Kult, Gebete und Prozessionen. So entstand folgendes Gedicht:
Am Vorabend
des Fronleichnamstags
Die Burschen stellen die Stangen auf;
Die Mädchen knüpfen und banden
Tagsüber aus duftigem Tannenreis
Die Sträuße und Girlanden.
In der Mitte des Dorfes, beim Kruzifix,
Geschmückt von den Mädchen und Frauen,
Die erste Station, der erste Altar
So lieblich anzuschauen!
Ein Stückchen dorfein dann
die zweite Station;
Die Dritte: Da unter der Linde,
Umstellt und umhangen mit Blumen so reich
Als heilige Angebinde.
Die vierte Station vorbei am Kreuz
Auf luftiger Höh da droben
Altarbekränzt,um morgen am Fest
Den Schöpf er zu loben.
Das alte Kirchlein! Verträumt steht es da,
Verwundert ob der duftenden Fülle,
Die liebevoll man ihm angedeiht
In Dämmerungs Stille.
Die neue Kirche Glanz in Glanz,
Rings Blumen aus Garten und Hag,
Rings Duft in Duft, denn morgen ist
Fronleichnamstag!
Karl Knauft hat es nicht zum Schriftsteller mit klingendem Namen gebracht. So still und unbemerkt, wie er gekommen, so ist er eines Tages auch wieder gegangen, immer noch auf der Suche nach ein wenig Glück und Verdienstmöglichkeit. Nicht die Alten, sondern nur die ganz Alten in Berndorf werden sich noch seiner erinnern.
Sein Büchlein »Mater Eiflia«, dem diese Gedichte entnommen sind, ist zur Rarität geworden. Dafür sorgte das grausame Kriegsgeschehen im 2. Weltkrieg, das grade die Eitel so hart getroffen hat.
Ich selbst behalte Karl Knauft in guter Erinnerung, als Poet und liebenswerten Menschen, der die Eifel liebte, sie besang und dort eine Weile glücklich war.