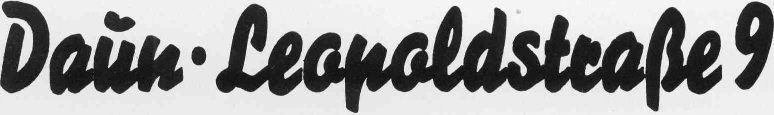
ZEITBILDER DER KREISGESCHICHTE
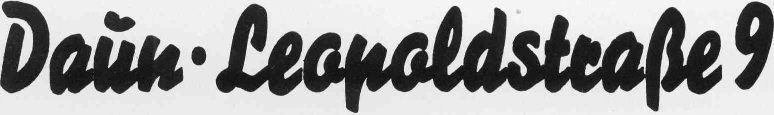
Nico Sastges
Mit den Portraits der Landräte Avenarius, von Seasinsky, Dr. Aschenborn, Foerster, Eich, Rinteln und Dr. Gehle, versuchte der Chronist in Beiträgen der Jahrbücher 1981 und '82 kreiskommunales, wirtschaftliches und kulturelles Leben im Kreise Daun von 1816 (der Kreisgründung) bis 1885 darzustellen. Die Fortsetzung der Studie im vorliegenden Jahrbuch umschließt den Zeitraum von 1885 bis 1922 mit Rückblick auf das Wirken der Landräte Graf von Brühl, von Ehrenberg und Weismüller. Die Chronik ruft über die Jahrhundertwende und den ersten Weltkrieg hinweg viele Daten und Ereignisse in Erinnerung, die Heimatgeschichtliches auffrischen und in einzelnen Phasen manchen aktuellen Entwicklungen näher stehen als wir in der Hast des gegenwärtigen Alltags nachempfinden. Selbst im Zeitraffer, der keinen Anspruch auf erschöpfende Darstellung erhebt, könnten die hier vermerkten Ereignisse zur Stärkung des Geschichtbewußtseins der jüngeren Generation beitragen, der Kreisgeschichte um die Jahrhundertwende, also in der Jugendzeit ihrer Großeltern, schon in weite Ferne gerückt ist.
Graf von Brühl
1885 bis 1889
Dem Dienstantritt des Landrats Graf von Brühl war ein Jahrzehnt der Mißernten und der Not vorausgegangen. Die Aufnahme von Notstandsdarlehen durch den Kreis half über die Ernährungskrisen hinweg. Die Einsicht zum Zusammenschluß in Wiesengenossenschaften zur Verbesserung der Weiden und der Viehzucht, Förderung der Saatfruchtbeschaffung sowie des durch die ersten Bahnverbindungen sich anbahnenden Handels, daneben die Einrichtung von Telegraphendienststellen in den größeren Orten waren bedeutsame Schritte zur wirtschaftlichen Neuorientierung.
Zur Überwindung des anhaltenden wirtschaftlichen Notstandes wurden 1883/84 erstmals 200 000 Mark Staats- und 100 000 Mark Provinzbeihilfen gewährt, besonders zur Bodenverbesserung zwecks Hebung der Viehzucht. Aus Mitteln des Kultusministeriums wurde 1883 in Daun eine Korbflechtschule eingerichtet mit sechs Lehrlingen. Die weitere Ausdehnung der Wiesengenossenschaften und des landwirtschaftlichen Kasinos neben den Bauernvereinen untermauerte zielstrebige Verwaltungsarbeit.
Landrat Graf von Brühl wandte sich zunächst initiativ gegen die herkömmlich bestehende Haltung von Leihvieh. 1887 gründete er mit Zustimmung der kreiskommunalen Gremien die Kreishilfskasse zur Überwindung des Viehverleihes durch Händler. Dadurch konnten bedürftige Landwirte und Viehhalter sich bei mäßigen Zinssätzen einen eigenen Viehbestand gründen. Diesem Beispiel folgten bald auch andere Kreise und die Hilfskasse war im Kreise Daun noch über den Zweiten Weltkrieg hinaus tätig.
Daneben waren um die 80er Jahre die Bemühungen um Nebenerwerbstätigkeiten auf einigen gewerblichen Sektoren wie der Drahtwarenindustrie und der Webwarenfertigung durchaus erfolgversprechend. 1885, kurz nach der Amtsübernahme, legte Landrat von Brühl den Grundstein für den Bienenzuchtverein Daun. Von den Bienenstöcken, die mit finanzieller Unterstützung des Kreises zur Ausnutzung der Heideblüte in das Kreisgebiet gebracht wurden, hatten die volksreichsten schon nach drei Wochen durchschnittlich 50 Pfund an Gewicht zugenommen. Später wurden in Neunkirchen, Darscheid, Gerolstein und Mehren örtliche Bienenzuchtvereine gegründet, die sich dann zum Kreisverband zusammenschlössen.
1887 gewährt der Kreis zu verbilligten Bedingungen der Nerother Drahtwarenindustrie ein Darlehen von 2 700 Mark. Dieser Zweig der Heimindustrie hatte sich so vervollkommnet, daß daraus die Bezeichnung Neroths als Heimarbeiterdorf bis in die Krisenjahre nach dem Ersten Weltkrieg bestehen blieb. Selbst in der Wirtschaftskrise 1928 bis 1932 wurde in manchen Familien in Neroth die ererbte Heimarbeit wieder aufgenommen, wenngleich diese nicht mehr zur Blüte gelangen konnte.
Zu den bedeutsamen Ereignissen während der knapp fünfjährigen Dienstzeit von Landrat von Brühl zählt die Eröffnung der Landwirtschaftsschule Hillesheim 1888, die den Grundstein zur Heranbildung eines nach wirtschaftlichen Grundsätzen wirkenden Bauerntums bildete. Noch weitreichender waren die Ziele des im gleichen Jahre gegründeten Eifelvereins gesteckt, woran der Dauner Landrat maßgeblichen Anteil hatte. Damit wurde eine Plattform geschaffen, die Eifel einem größeren Kreis von Naturfreunden zu erschließen. Diesen Zielen diente auch die Förderung der Ausgrabungen durch das Provinzialmuseum in Trier, das vor allem den vorrömischen Funden bei Mehren, am Steineberger Ringwall, bei Demerath, Ellscheid und im Lehwald bei Daun nachspürte und diese Arbeit in der Folge auf das gesamte Kreisgebiet ausdehnte
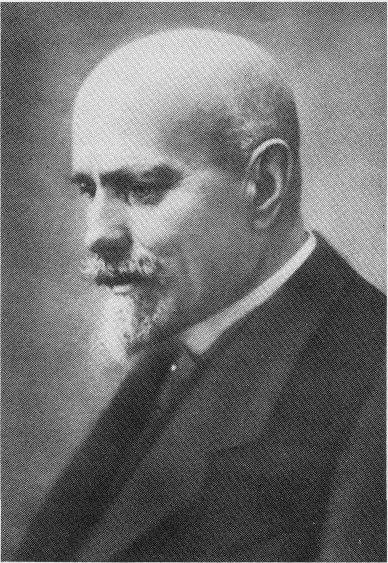
So rückte Landrat Graf von Brühl das Ringen um die Verbesserung des Lebenserwerbs in enge Beziehungen zur historischen Entwicklung. Die Chronisten der damaligen Zeit berichten, daß der Landrat auch dem kulturellen Leben in den größeren Gemeinwesen des Kreises seine Aufmerksamkeit widmete und versäumte nicht, durch Einladungen hoher Ministerialbeamter überörtliche Hilfen »für den ärmsten Kreis der Rheinprovinz« zu erreichen. Daß es ihm gelang, für einige Jahre die Eifel von Korpsmanövern zu verschonen, dürfte seinen persönlichen Beziehungen zum Generalstab der damaligen Heeresleitung zuzuschreiben sein.
Landrat
von Ehrenberg
1889 bis 1907
Herr von Ehrenberg stammte aus Hohenzollern und war in seiner 18jährigen Tätigkeit als Landrat im Kreise Daun wohl die stärkste Führungspersönlichkeit des vergangenen Jahrhunderts. Sein Wirken umschloß fast alle Gebiete des Lebens. Bei der älteren Generation steht er heute noch in bester Erinnerung. Dauns Stadtrat ehrte ihn durch die Benennung einer Straße, die seinen Namen trägt. Ehe er 1907 nach Wiesbaden verzog, so berichtet mündliche Überlieferung, bemühte er sich darum, den Namen der Gemeinde »Betteldorf« durch »Ehrenberg« zu ersetzen. Dieses Vorhaben scheiterte jedoch am Preußischen Generalstab, der wegen der alljährlichen Kaisermanöver in der Eifel die Generalstabskarten nicht ändern wollte. Abgesehen von dieser Episode, veranlaßte von Ehrenberg die Übernahme des Landratsamtes, dessen Eigentümer die Gemeinde Daun war, durch den Kreis. Der Kaufvertrag wurde nach Beschluß des Kreistages 1892 getätigt. 1906 erhielt der Ständesaal im Kreishaus gemalte Fenster, neben dem Reichs- und preußischen Wappen die Hoheitszeichen der geschichtlichen Landesgebiete, die den Kreis bilden: Die Wappen des Erzstiftes Trier, der Herrschaft Daun, der Grafschaften Gerolstein und Manderscheid sowie der Freiherrschaften Jünkerath und Kerpen. Ferner wurde das Kreishaus erweitert.
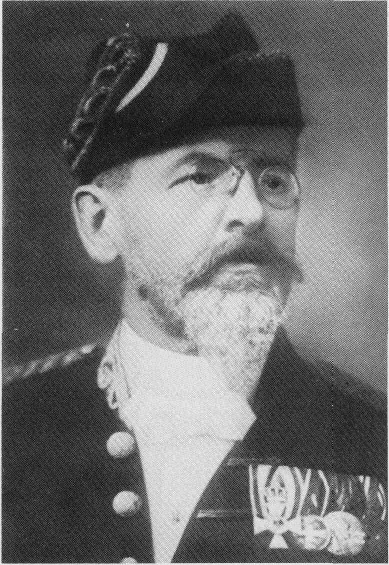
Von Ehrenberg wirkte in einer Zeit, die ausgefüllt war vom Streben nach wirtschaftlicher Besserung. Sie wird deutlich in einigen Daten: 1890 wissenschaftliche Untersuchungen zur wirtschaftlichen Nutzung des Vulkansandes, »Der Sand stellt«, wie die Handelskammer Trier berichtet, »ein seltenes und hochwertiges Material dar.« Das Ministerium für Handel und Gewerbe bewilligte im gleichen Jahr einen Staatszuschuß von 1 500 Mark für weitere Untersuchungen des Eifler Vulkansandes. Eine Dauner Zementfabrik beginnt 1897 erstmalig mit industrieller Verwertung des Vulkansandes.
1892 beteiligt sich der Gerolsteiner Sprudel an der Weltausstellung in Chikago. Der Gerolsteiner Schloßbrunnen richtete 1892 am Dreiser Weiher ein Brunnenunternehmen ein. 1893 wurden bei Kerpen und Üxheim Versuche mit gewonnenem Marmor angestellt. Der Regierungspräsident besichtigte mit dem Landrat die Marmorfunde bei Kerpen am 13. Oktober 1896. 1899 begann eine Firma mit der Ausbeute des Marmors. In der Bahnhofshalle in Bonn und im Innern der Erlöserkirche in Gerolstein wurde später Kerpener Marmor verwendet.
Am 15. Mai 1895 wurde die Eisenbahn Gerolstein Daun Mayen feierlich eröffnet. Im gleichen Jahre hatte der Kreis Daun eine Anleihe von 100 000 Mark für diesen Bahnbau aufgenommen. Der Zerstückelung des Grundbesitzes wurde durch Flurbereinigung vorgebeugt. 1890 war die Zusammenlegung in Kradenbach beendet, dann folgten 1891 Hillesheim, 1892 Neichen und Utzerath und 1893 Sarmersbach
und Heyroth. Die sogenannte Eifelkonferenz bewilligte für die Zusammenlegungen aus Staats- und Provinzialmitteln erhebliche Gelder. Später flössen für Zusammenlegungen Beihilfen aus dem Westfonds.Für Meliorationen und Bodenverbesserungen erwirkte Landrat von Ehrenberg jährlich beträchtliche Zuschüsse. 1890 wurden für die Kyllregulierung Lissendorf und Birgel aus Staatsund Provinzialmitteln 39 000 Mark bewilligt. Der Flußlauf wurde durch diese Regulierung von 5 000 Metern auf 2 500 Meter verkürzt. Es wurden dadurch 80 Morgen Wiesen gewonnen.
Von Ehrenberg setzte sich auch für die Hebung der Fischerei ein, 1897 wurden 51 Fischereigenossenschaften gegründet, nachdem schon 1890 auf seine Veranlassung 50000 junge Edelfische in das Weinfelder Maar und 1893 in der Kleinen Kyll und im Salmbach 10 000 junge Forellen eingesetzt worden waren.
1893 bezeichnet ein Grubensteiger aus dem Ruhrrevier das Kohlenlager bei Neroth-Ober-stadtfeld als günstig. Sämtliche bis dahin aufgedeckten 20 Flöze wurden als abbauwürdige Fettkohle bezeichnet. Der Abbau wurde aber später wieder eingestellt. Bei Neunkirchen wurde 1893 bei neun Meter Tiefe ein zwei Fuß starkes Kohlenflöz gefunden. Desgleichen 1895 Kohlenfunde bei Neroth und 1896 bei Darscheid.
Der Kreis Daun beteiligte sich 1899 an dem mit 11 000 Mark aus dem Eifelfonds neuerrichteten Torfstreuwerk im Kyllwald zwischen Mürlenbach und Salm. 1904 wurde einem auswärtigen Unternehmer das Bergwerkseigentum für Eisenerze verliehen. 1906 wurde der Bleibergbau bei Niederstadtfeld begonnen, aber nach kurzer Zeit wieder eingestellt. 1901 wurde der bis dahin bestehende Eifelfonds zur Behebung der Not mit dem neugebildeten rheinischen Westfonds verschmolzen. Landrat von Ehrenberg verstand es, aus diesem Fonds jährlich erhebliche Mittel für Bodenverbesserungen, Viehhaltung, Hanf- und Flachsanbau, Wasserversorgungsanlagen und Dungstätten zu erwirken.
Die Kreishilfskasse wurde 1902 verstärkt. Es konnten dadurch 152 Stück Vieh an 89 Landwirte unter günstigen Bedingungen ausgeliehenwerden. Dieses Vieh ging in Privateigentum über.
Am 17. April 1892 brannten in Weidenbach 42 Anwesen ab. In Oberstadtfeld brannten am 16. Juli 1902 18 Wohnhäuser und 9 Scheunen. Der Kronprinz von Preußen besuchte die Brandstelle in Oberstadtfeld und spendete Hilfe.
1894 wurde auf Initiative des Landrats in Daun eine Präparandenanstalt zur Vorbereitung für das Lehrerseminar eingerichtet. Diese Anstalt wurde 1904 wieder aufgehoben. Der Kreistag beschloß am 11. April 1906 die Einrichtung einer Kreishaushaltungsschule. Es wurden sechswöchige Lehrgänge abgehalten.
In Mirbach wurde 1903 die Erlöserkapelle errichtet. Hierbei wurden die Fundamente der im 17. Jahrhundert niedergebrannten Burg freigelegt. Über Kapelle und Burg Mirbach wurden 1904 zwei Geschichtswerke vom Freiherrn von Mirbach herausgegeben.
Am 19. Juli 1892 besichtigte der Regierungspräsident mit einer Kommission im Beisein des Landrats die Meliorationsanlagen im nördlichen Kreisteil und in der Struth, unterwegs auch die Fabrik am Dreiser Weiher und die Drahtwarenherstellung in Neroth. Der Gerolsteiner Sprudel hatte Mitte August 1893 den Versand von einer Million Flaschen für dieses Jahr überschritten. Am 12. Oktober 1900 beginnt die Heilquelle »Vulkan« in Daun mit dem Versand.
1900 umfaßte die Molkereigenossenschaft Hillesheim neun Orte. Im gleichen Jahr wurde von dieser Molkerei eine Badeanstalt in Hillesheim eröffnet. Weitere Molkereien bestanden in Dockweiler und Mehren. Diese wurden aus dem Westfonds gefördert.
1903 weist Landrat von Ehrenberg empfehlend auf das Preisausschreiben des Regierungspräsidenten zur Erlangung von geschmackvollen Entwürfen zu Bürger- und Bauernhäusern hin. 1906 richteten 21 Dörfer eine Eingabe an den Kreis zum Ausbau einer Provinzialstraße Daun Bitburg. Der Regierungspräsident besichtigte mit dem Land und einer Kommission die Wegeverhältnisse. Bei Einrichtung des vom Kreistag beschlossenen Kreisfernsprechnetzes erhielt der Kreis Daun 65 neue Telegraphenhilfstellen. Am 20. Oktober 1906 hat zum erstenmal seit kurtrierischen Zeiten der oberste Landesherr Kaiser Wilhelm II. den Kreis Daun besucht. Er wurde in Daun festlich empfangen. Das Frühstück wurde im Hotel Schramm in Daun eingenommen. Der Erfolg war, daß auf eine Eingabe des Landrats einige Jahre später in Daun die zentrale Wasserleitung gebaut werden konnte. Von Ehrenberg überzeugte mit der Einrichtung einer Verwaltungsschule für junge Beamte und Gehilfen, die er persönlich unterrichtete, aber auch seinen Weitblick in der Verwaltung. Daneben schrieb er zahlreiche Beiträge zur Heimatgeschichte und redigierte zeitweise das Kreisblatt. In seiner Uniform, die damals für Landräte vorgeschrieben war, ist sein Persönlichkeitsbild den älteren Kreisbewohnern in der Erinnerung haften geblieben, wie sein Wirken, in dem er Treue zum Staat, Fleiß, Umsicht und Verantwortungsbewußtsein zum Wohle der Kreisbevölkerung verkörperte.
Landrat Weismüller
1907 bis 1922
Landrat Weismüller, von Geburt Bauernsohn, widmete sich in besonderer Weise der Hebung der Landwirtschaft. Seinem Vorschlag zur Aufstockung der Kreishilfskasse zum Viehkauf stimmte der Kreistag durch die Aufnahme einer Anleihe von 10 000 RM zu. Dadurch wurden bis 1914, kurz vor Kriegsausbruch, 199 Stück Vieh an 124 Landwirte vermittelt.
Weismüllers Initiative richtete sich im Verwaltungsbereich auf den Umbau des Kreishauses, womit 1909 begonnen wurde. Da das Bauen damals nicht nach heutigen Zeitmaßstäben voranging, konnte der Kreissaal in seiner heutigen Gestaltung erst 1913 seiner Bestimmung übergeben werden. Die Aufnahme von sieben markanten Gemälden des Eifelmalers Fritz von Wille in den Kreisständesaal bilden auch heute noch eine Zierde im Foyer des Landratsamtes.
Die Jahre vor dem Ersten Weltkrieg waren im Kreise Daun von mannigfaltigen bedeutsamen Ereignissen der Eifel-Erschließung ausgefüllt. 1910 erweiterte sich das Bahnnetz um die Linie Daun Wittlich Wengerohr. 1912 folgte die Inbetriebnahme der Eisenbahnlinie Lissendorf Hillesheim Dümpelfeld, womit eine Verbindung zur Ahr geschaffen wurde. Anfang 1914 wurde im preußischen Landtag eine Eisenbahnstrecke Adenau Daun genehmigt, die jedoch infolge des Kriegsausbruchs nicht mehr in Angriff genommen wurde.

Indessen war bereits 1908 mit dem viergleisigen Ausbau der Eisenbahn Köln Trier zwischen Jünkerath und Lissendorf begonnen worden. 1912 wurde ferner die Eisenbahnlinie Hillesheim Gerolstein (12 km) in Betrieb genommen, doch schon nach dem Ersten Weltkrieg mußte diese Linie auf Anordnung der Besatzung stillgelegt werden, weil sie, wie man schmunzelnd hinzufügen muß, »als eine rein strategische Linie« angesehen wurde. Der Zweite Weltkrieg fegte infolge restloser Zerstörung der Brückenbauwerke die Linie aus dem Eisenbahnnetz weg.
In Jünkerath wurde 1911 eine gewerbliche Fortbildungsschule eingerichtet, und im gleichen Jahr stimmte der Kreistag in der Frühjahrssitzung der Einrichtung einer Fürsorgestelle zur Bekämpfung der Tuberkulose zu. Diese Krankheit griff damals rasch um sich, so daß noch 1922 trotz starker Eindämpfung ihrer Verbreitung im Kreisgebiet noch 38 Personen an Tuberkulose starben. Ein Jahr später befanden sich noch 223 Personen in der Obhut und Betreuung der Lungenfürsorgestelle.
Die wirtschaftliche Entwicklung verzeichnete 1908 bei den Mineralbrunnen und Kohlesäurewerken in Gerolstein und Pelm 300 Belegschaftsmitglieder, beim Dauner Sprudel 50 Beschäftigte. Die Belegschaft der Jünkerather Gewerkschaft (Maschinenfabrik) stieg nach 1908 von 230 bis 1912 auf 400 Personen. Am 30. Januar 1913 beschloß der Kreistag auf Vorschlag des Landrates die Gründung der Allgemeinen Ortskrankenkasse des Kreises Daun.
Am 20. Oktober 1911 besuchte Kaiser Wilhelm II. zum zweiten Male den Kreis Daun und war 1913 zum dritten Male Gast in Daun und Gerolstein, wo 1913 im Beisein des Kaisers die evangelische Erlöserkirche eingeweiht wurde. Bei dem Kirchenbau wurde die römische Siedlung »Villa Sarabodis« ausgegraben. Seinen Besuch im Kreisort krönte der Kaiser mit der Stiftung einer eigenen Bronzebüste, die einen Ehrenplatz im Kreissaal fand, doch nur die Kriegsjahre überdauerte und seither nirgendwo mehr aufgetaucht ist.
Landrat Weismüller bemühte sich während des Ersten Weltkriegs darum, die steigenden Kriegslasten für die Bevölkerung zu mildern. Vor allem die Ernährungsschwierigkeiten erforderten Woche um Woche neue Anstrengungen. 70 Kinder aus Köln und Rheydt waren gegen Kriegsende im Kreise Daun untergebracht. Für die gute Aufnahme und Betreuung wurde dem Landrat öffentlicher Dank der beiden Städte zuteil.
Doch Wege und Straßen waren nach dem Auf-und Rückmarsch der Truppen und dem Einzug der Besatzungstruppen restlos zerfahren. Bis1922 gelang es der Initiative des Landrats, daß rund 70 km Durchgangsstraßen wieder instandgesetzt waren.
Als nach dem Kriege amerikanische Besatzungstruppen einrückten, wurde auch der Büroraum im Landratsamt eng. Daher mußten verschiedene Abteilungen der Kreisverwaltung in andere Häuser verlegt werden. Landrätliche Bekanntmachungen wurden in den ersten Wochen nach Kriegsende 1918 vorübergehend vom Arbeiter- und Soldatenrat mitunterzeichnet.
Am 17. Dezember 1918 wurde die erste Bekanntmachung der amerikanischen Besatzung in zwei Sprachen veröffentlicht. Ab Juni 1919 war der Kreis Daun von einer Militärpolizeikompanie besetzt; ein amerikanischer Verwaltungsoffizier blieb in Daun. Später wurden die Amerikaner von französischer Besatzung abgelöst. Der Siegesruhm trieb nicht die besten Blüten. Landrat Weismüller geriet auf die Liste derer, die nicht genehm waren. Im Januar 1922 wurde er von der Interalliierten Rheinlandkommission seines Amtes als Landrat von Daun enthoben. Zunehmende Not trieb im gleichen Jahr über 2 000 Arbeitskräfte aus dem Kreise Daun in die Fremde.