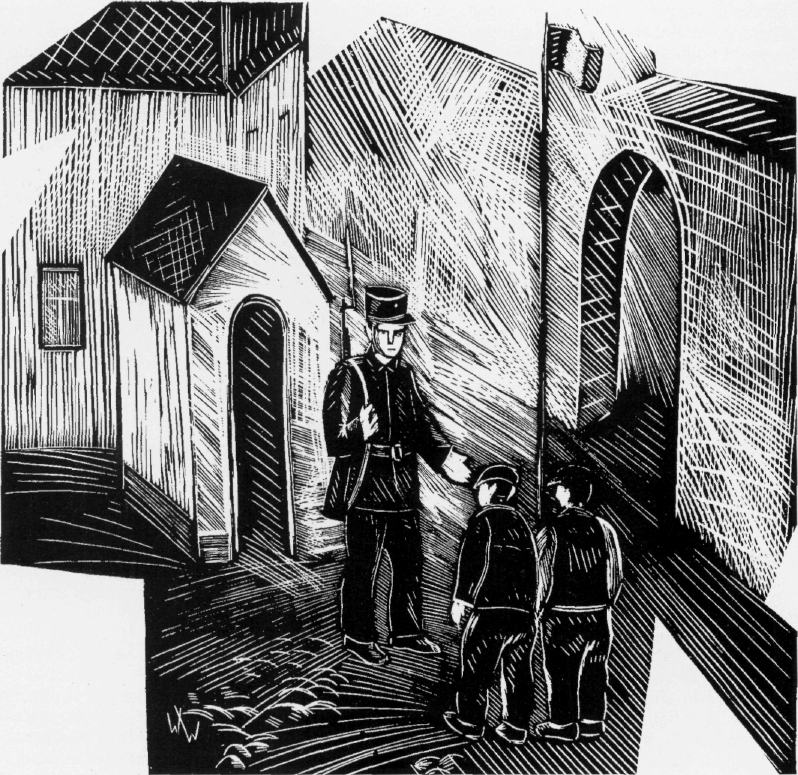
Das Kriegsende als Kind erlebt
Franz-Josef Ferber,Daun
Das genaue Datum weiß ich nicht mehr mit Bestimmtheit zu nennen, es muss wohl am 6. März 1945 gewesen sein, als ich morgens ins Dorf ging. Dort kam mir einiges verändert vor. Soldaten in fremdländtschen Uniformen fuhren mit Panzern und Lastwagen hin und her. Am Viehweg schlugen sie große Zelte auf. Die Dorfleute schauten in gebührendem Abstand dem regen Treiben zu, die Ängstlicheren blieben in ihren Häusern und beobachteten alles durch die Gardinen. Schnell wurde ich gewahr, was los war. »De Krehch öß uß!«, belehrten mich meine älteren Kameraden. Die Soldaten, die in der vergangenen Nacht Hörschhausen zu belagern begonnen hatten, waren Amerikaner, also Feinde. Von Feindschaft konnte ich allerdings auch in den folgenden Tagen nicht viel spüren.
Eigentlich waren die Amerikaner uns Jungen ganz und gar willkommen. Es gab nämlich bei ihnen viel Neues zu sehen, zu erleben und von ihnen so manches zu erhäschen. Neu für uns war vor allen Dingen der Kaugummi; wir kannten ihn nur vom Hörensagen. Wie Apfelsinen aussahen und wie sie schmeckten, das wussten die Jüngeren von uns bis dahin auch nicht. Aber kaum hatten die Amerikaner ihre Zelte aufgeschlagen, ließen wir - das heißt Schang und ich - uns ihre Limonade aus Amerika trefflich schmecken.
Auf der Straße bei »Schäwwes Nikela« hatten die Amis einen Lastwagen abgestellt. Er war mit Limonadenkisten beladen. Das hatte Schang schnell herausbekommen. Und ohne »unseren Teil" bekommen zu haben, konnten wir das Auto unmöglich weiterfahren lassen. Auf der Straße und rundherum war im Augenblick niemand zu sehen, der einzige Mensch in unserer Nahe war ein Soldat, ein Amerikaner. Er saß am Steuer des Wagens und döste vor sich hin. Die Gelegenheit, ohne ertappt zu werden, sich an die Limonade heranzumachen, war in diesem Moment besonders günstig. Mit Hilfe von Schang zog ich mich an der hinteren »Bracke« hoch, griff hastig in eine der Kisten und nahm zwei Flaschen gelber Zitronentimonade heraus, eine Flasche für mich und eine für Schang. Unauffällig verschwanden wir durch »Rinnartz« Hof. Im Schütze des Eberstalles konnten wir uns ungestört an dem amerikanischen Getränk laben.
Schange und einige andere Familien wurden aus ihren Häusern gejagt. Die Amerikaner machten es sich darin gemütlich, vor anderer Leute Eigentum schienen sie nicht den wünschenswerten Respekt zu haben, denn sie stahlen nicht nur deren Sachen, sondern machten sie zuweilen auch kaputt. Mit Schange musste auch ihre Mieterin, die Erna, eine junge Kriegerwilwe! mit ihrer Meinen Tochter, dem Hannelorchen, ausziehen. Ihre Schallplatten nahmen die Amis in Besitz, wirbelten sie auf den großen Wiesen am Kändel solange durch die Luft, bis sie total demoliert waren. Ab und zu warfen sie auch Sachen weg, zum Beispiel ein Motorrad, das ihnen partout nicht den Gefallen tun wollte, anzuspringen. Das war - so sagten wir uns - die Strafe dafür, dass sie es irgendwo gestohlen hatten, getreu dem Sprichwort: »Unrecht Gut gedeihet nicht".
Nach kurzer Zeit wurden wir gewahr, dass die Besatzungssoldaten es auf Hühnereier abgesehen hatten, und davon gab's bei uns zu Hause genug. Deshalb lag es nahe, mit den fremden Männern Tauschgeschäfte zu machen. Ich war vornehmlich an Kaugummi, Apfelsinen und Schokolade interessiert. Morgens, in aller Herrgottsfrühe, raffte ich alle Eier zusammen, die unsere Hühner nachts zuvor gelegt hatten, stopfte sie in meine Hosentaschen und machte mich ganz vorsichtig auf zu Schange Haus, worin die Amerikaner kampierten. Die Haustür war unverschlossen. Leise klopfte ich an die Küchentür. Niemand schien bereit zu sein, mich zu empfangen. Ganz vorsichtig öffnete ich die Tür einen kleinen Spalt breit, um den Grund der Stille zu erfahren. Dort, auf dem Boden, in voller Militärkleidung, lagen meine Tauschpartner im tiefen Schlaf. Penetranter Alkohol- und Zigarettengeruch schlug mir entgegen, zu Tauschgeschäften war keiner der Schläfer aufgelegt. Trotzdem war mein frühmorgendlicher Besuch nicht vergebens. Einem der Schlafenden, demjenigen, der nahe der Tür lag, war ein goldfarbenes, ziseliertes Taschenmesserchen aus der Hosentasche gefallen. Spontan und etwas umständlich der Eier wegen, versteht sich hob ich es auf und schlich mich davon. Alles blieb still. Einzig und allein mein Herz pochte wild vor Angst. An diesem Morgen bekamen mich die Amis nicht mehr zu sehen, und niemand konnte mir vorwerfen, ich habe etwas gefunden, was noch keiner verloren hatte.
Schon in den ersten Tagen ihres Hierseins forderten die Amerikaner die Leute auf, alles abzuliefern, was für einen Krieg hätte nützlich sein können. Vor allem Schusswaffen, Säbel, Seitengewehre und Messer ab einer bestimmten Länge waren abgabepflichtig. Alles musste zu Zeduschens Pitta, dem Orts Vorsteher, geschafft werden. Das Magazin mit der Zwei-Zentimeter-Flak-Munition, das wir in »Hummes Böscheltje« gefunden hatten, brachten wir auch dort hin. Anfangs waren wir erleichtert, die äußerst gefährlichen Dinger los zu sein. Es waren nämlich Explosivgeschosse; die Kugeln explodierten, wenn sie am Ziel angekommen waren. Vorsichtig hatte Pitta sie in seinem Holzschuppen zum Abholen paratgelegt. Nach ein paar Tagen fuhr ein Lieferwagen der Amerikaner an, um das Sammelgut abzutransportieren. Vielleicht war es ein Zufall, dass wir rechtzeitig zur Stelle waren. Es kann aber auch sein, dass wir uns bei Zeduschens aufhielten, weil der Schange Helmut dort wohnte. Die Amis hatten, wie gesagt, seiner Familie befohlen, ihr Haus zu räumen. Was hatte das Auto nicht alles geladen! Es waren ausnahmslos - jedenfalls aus unserer Sicht - begehrenswerte Sachen: Karabinermunition, Pistolenkugeln, Ferngläser, Fotoapparate, ein Flobert und unzählige andere Dinge. Wir wurden zusehends nervöser und begieriger. Allein die Vorstellung, den schönen Flobert den Amis überlassen zu müssen, war zum Verzweifeln. Aber es half nichts. Keiner von uns traute sich zuzulangen. Die beiden Soldaten waren zwar ins Haus gegangen, aber die Stube, das wussten wir, hatte ein Fenster zum Hof, und wir mussten damit rechnen, hierdurch beobachtet zu werden. Wohl oder übel sahen wir ein, dass es diesmal klüger war, zu verzichten. Letztlich fielen uns die Flakgeschosse ein, die im Schuppen lagen. Wir betrachteten sie ohnehin als unser Eigentum. Sie sollten nun die längste Zeit dort gelegen haben; sie waren zwar den Amis zum Mitnehmen vorbehalten, aber so weit ließen wir es nicht kommen. Wir schlichen uns in den Schuppen, nahmen unser prallvolles Geschossmagazin und trugen es behutsam in Schange Schuppen. Dort spannte Schang die Geschosse nacheinander in den Schraubstock, montierte fachmännisch die explosiven Kugeln ab, und wir begruben sie am Wegrand. Die Pulversäckchen nahmen wir aus den Kartuschen, schütteten das Pulver auf einen Haufen und zündeten es an.
Die Amerikaner schrieben der Bevölkerung vor, ab wieviel Uhr sie abends in ihren Häusern zu bleiben hatte. »Ausgangssperre« nannte man diese Zwangsregelung. Meiner Erinnerung nach durfte man sich ab 18.00 Uhr nicht mehr draußen sehen lassen. Das alles interessierte uns Jungen keinen Deut. Wir versuchten, unsere Gewohnheiten beizubehalten. Hierzu gehörte nun mal das allabendliche Streunen durchs Dorf nach Anbruch der Dunkelheit, verbunden mit Streichen, die wir den Leuten machten. Was die »Schelmestöcka« angeht, so dachten wir daran, anstatt die Dorfleute auch mal die Amis zu ärgern, die schließlich in unserem Dorf nichts zu suchen hatten. Sie herauszufordern, das war kein Kunststück. Man brauchte ihnen nur zu zeigen, dass man auf ihre militärischen Anordnungen pfiff, und so rafften wir eines Abends allerlei Brennbares zusammen, vorzugsweise die leeren Schachteln, die die Amerikaner weggeworfen hatten; sie waren aus einer Art Wachskarton hergestellt, weshalb sie leicht brannten. Das ganze Zeug häuften wir am Viehweg, neben Schange Gartenzaun, auf, "Würzten" es noch mit einigen Karabinerkugeln, und kaum war die Dunkelheit angebrochen, zündeten wir den Haufen an. Nach einer Weile loderten die Flammen zum Himmel und die Gewehrkugeln begannen nacheinander zu explodieren. Dies alles erregte den Unmut der Amerikaner. Wie wild strömten sie aus den nahen Zelten und den requirierten Häusern, verzweifelt suchten sie nach den Übeltätern. Doch wir hatten den Zeitvorsprung, die Dunkelheit und unsere Ortskenntnisse dazu benutzt, uns unauffällig aus dem Staub zu machen.
In Siebenmeilcnstiefeln zur Ncgcrschau
Die Amerikaner, die in unser Dorf eingezogen waren, sahen so aus wie die Deutschen. Eigentlich erkannte man sie nur an ihren Uniformen, allenfalls noch an ihren kurzgeschnittenen Haaren. Für uns Kinder war enttäuschend, dass sie keine Neger mitgebracht hatten. Keiner von uns hatte jemals einen richtigen Neger gesehen. Von schwarzhäutigen Menschen hatten wir eine vage Vorstellung. Ich versuchte, mir von ihnen ein Bild zu machen, indem ich mir einen der Heiligen Drei Könige, den Mohrenkönig- der Balthasar soll es gewesen sein - aus der Weihnachtskrippe unserer Pfarrkirche im Geiste vornahm.
Bald hatte sich herumgesprochen, dass unter den amerikanischen Soldaten, die Schönbach besetzt hatten, Neger seien. Die mussten wir natürlich zu sehen bekommen. Wir vier Jungen- Schang, Fred, Kläre Jupp und ich - machten uns auf den Weg dorthin. Wir gingen die holprige Straße am Utzeralher Bahnhof vorbei, durchquerten Utzerath und eilten in Richtung Schönbach. Für mich war der Gang besonders beschwerlich in den mächtigen Wehrmachtsstiefeln, die deutsche Soldaten liegen ließen und mir als Ersatzschuhe dienten. Die Stiefel waren etliche Nummern zu groß, schlotterten fürchterlich, reichten mir ein gutes Stück über die Knie, und ihre Last war um einiges zu schwer.
In Utzerath angekommen, fühlten wir uns gedrängt, den Fußmarsch zu unterbrechen. Eine kurze Rast tat gut. Das allein war aber nicht der Beweggrund, am Dorfeingang, im Pasch des ersten Hauses, lag Kriegsgerät verstreut umher. Es waren in der Hauptsache Gasmasken, sorgfältig m ihren geriffelten Blechbehältern, die mit Tragriemen versehen waren, verstaut. So etwas konnten wir natürlich gut gebrauchen. Nur im Augenblick kamen diese Dinge uns ungelegen. Deswegen beschlossen wir, nachher auf dem Rückweg mitzunehmen, soviel wir tragen konnten. Und auch den in unmittelbarer Nähe, direkt am Wege, der zürn Hummerich führt, stehenden Panzer der Deutschen Wehrmacht zu inspizieren, hatten wir uns für diesen Zeitpunkt aufgespart.
Eine Viertelstunde später standen wir bereits vor den ersten Häusern von Schönbach. Kurz vor dem Dorf, in einem engen Seitentälchen, durch das man auf kürzestem Weg den Kreuzberg erreichen kann, erspähten wir einen Lieferwagen. Deutsche Soldaten hatten ihn dort stehen lassen. Wir kramten in dem Zeug, das auf der Ladefläche des Wagens ungeordnet herumlag. Kläre Jupp raffle ein undefinierbares Ding heraus. Da es ihm unheimlich vorkam, warf er es in hohem Bogen weg. Sogleich quoll dichter Nebel aus dem Fundstück und verhüllte in Windeseile das Tälchen. Es war uns nicht wohl in unserer Haut, und wir machten uns schleunigst aus dem Staub. Bald waren wir im Dorf angelangt. Schneller als erwartet wurde unser Begehren, einen Neger zu sehen, befriedigt. Da schritt doch ein leibhaftiger dunkelhäutiger Soldat über die Straße. Er war so schwarzem Gesicht, als hätte man ihn gerade erst mit Schuhwichse eingeschmiert. Das einzige Weiß war das seiner Augen. Dieses stand in starkem Kontrast zu dem pechschwarzen Äußeren. Beim Anblick des fremden Soldaten waren wir ziemlich befangen. Etwas scheu musterten wir ihn von oben bis unten, wobei wir unsere Schritte verlangsamten, stehenzubleiben, getrauten wir uns nicht. Der Fremde jedoch nahm von uns keine Notiz, er schritt zielstrebig auf die andere Straßenseite, dem Lokus zu, der einsam in der Wiese stand. Er war der einzige schwarze Amerikaner, den wir an diesem Tage in Schönbach zu sehen bekamen.
Nach einem kurzen Besuch im Hause von Schangs Onkel Willi traten wir den Heimweg an. Aus dem Einheimsen der Gasmasken in Utzerath wurde zu unserer großen Enttäuschung nichts. Irgend jemand hatte mittlerweile die Sachen weggeschafft. Dafür hielten wir uns an dem Panzer schadlos. Mit einem Satz stand Schang oben drauf, verschwand sogleich im Inneren, tauchte bald wieder auf, mit der rechten Hand einen Karabiner schwingend. Dem fehlte nur das Schloss. Das machte nichts; solche und andere Ersatzteile hatte Schang genügend auf Lager.
Bevor wir den Ort des Geschehens verlassen konnten, wurden wir aufgehalten. Eine alte Frau, die in der Nähe wohnte, kam auf uns zu und begann zu lamentieren: »Ömm Jottes Welle, Könna, loaßt dat dreckesch Scheeßdinge läije. dia scheeßt Eusch joa duhd!« Schang hatte sofort eine Antwort parat: »Oach wat, Tant, Ina seeht doch sellewa, dat dat Dinge janz ka-bott öß (und dabei zeigte er auf die Gewehrschlosslücke). Ech hollen öt mia nümme füa mech dropp ze stäipe!« Und er tat dabei so, als habe er einen Spazierstock in der Hand, packte den Karabiner am Laufende und stützte mit dem Kolben auf. Die besorgte Frau ließ sich jedoch nicht besänftigen, sie beharrte energisch darauf, das Ding wegzuwerfen. Schang ließ sich nicht erweichen. Er dachte nicht daran, das Gewehr herauszurücken. Grinsend stolzierte er an der gutmeinenden Alten vorbei, die verständnislos dastand und unaufhörlich den Kopf schüttelte.
Am hellichten Tage konnten wir - wegen der Amis in unserem Dorf - den neuerworbenen Karabiner nicht nach Hause tragen. Deswegen versteckten wir ihn zunächst unterwegs, in der »Nürperheed«, dem Hörschhausener Gemeindewald.
Als die Franzosen kamen
Es dauerte nicht lange, da haben die Amerikaner ihre Zelte wieder abgebrochen. Auf einmal waren sie verschwunden. Die Franzosen nahmen ihren Platz ein und besetzten unsere Heimat. Von nun an bestimmten sie, was zu tun und was zu unterlassen war. Allerdings waren sie nicht ständig in den Dörfern präsent, sondern regierten das Land von der Kreisstadt aus. Dabei gingen ihnen unsere Landsleute oft bereitwillig zur Hand. Allenthalben kamen die französischen Besetzer, meistens in Begleitung von deutschen Amtsschreibern, in unsere Dörfer, um alles mögliche zu beschlagnahmen. Darunter litten die Menschen am meisten, besonders deswegen, weil die Fremden gerade das mitnahmen, was die Leute selbst dringend brauchten: Vieh, landwirtschaftliche Erzeugnisse, Fahrzeuge und vieles andere. Dass die Franzosen unsere Wälder abholzten und den Ertrag nach Frankreich schafften, war noch eher zu verkraften. Nicht Diebstahl, sondern »Requirieren" nannte man dieses Wegnehmen fremden Eigentums, und damit alles seine bürokratische
Ordnung hatte, richtete man für diese Zwecke bei der Landratur in Daun eigens ein Amt - das Requisitionsamt - ein. Dort wurden die "Raubzüge« organisiert, wie man nachträglich erfuhr, nicht immer zur Zufriedenheit der Besatzer. Diese haben (das ist mündlich überliefert) dem Chef der Kreisbehörde, dem gutmütigen Landrat Johann Feldges, mächtig zugesetzt. Auch unsere Familie wurde in jener Zeit arg drangsaliert. Im Jahr 1945 hatten wir zwei kleine Felder Kartoffeln gepflanzt, in »Platthausen« und in der »Wüsten Heide«. Die Früchte waren auch geerntet und hätten für unsere kleine Familie voll und ganz ausgereicht. Jedoch die Franzosen, besser gesagt die Deutschen auf Anordnung der Franzosen, haben sie uns bis auf einen bescheidenen Rest aus dem Keller genommen, so dass wir letzten Endes hungern mussten. Dies geschah unter den Augen des Ortsvorstehers Nikla und des Gendarms Nikolaus, und weil sie, die amtlichen Handlanger der Franzosen aus der Kreisstadt, gerade beim Beschlagnahmen waren, haben sie gleich noch das gute Fahrrad meines Vaters mitgenommen. Mein Onkel Heinrich, insoweit selbsternannter Sachwaller meines väterlichen Erbes, hatte es dem ziemlich wichtigtuerischen Beamten (beide kannten sich offensichtlich, denn sie duzten sich) bereitwillig ausgehändigt und so -gewollt oder ungewollt - von den eigenen Fahrrädern abgelenkt. Eines davon war sorgfältig auseinandermontiert in seiner Scheune versteckt.
Doch wir hatten auch Glück. Das war die Sache mit unserer HANS, von dem man sagte, sie sei die schönste Kuh des Dorfes. Kein Wunder also, dass die französischen Besatzungssoldaten sich für sie interessierten. Das wäre ihr (und uns) beinahe zum Verhängnis geworden. Unten im Dorf, an der Straßenkreuzung beim Duckes-päsch musste sie, zusammen mit anderem Rindvieh, den Franzosen zur Musterung vorgeführt werden. Aber die Musjöhs aus Frankreich nahmen sie nicht mit. Das behagte einigen Bauern aus dem Dorf ganz und gar nicht, wähnten sie dadurch - übrigens zu Recht - ihre eigenen Tiere abgäbe gefährdeter. Die wohlgenährte und gepflegte HANS war den fremden Herren schon gut genug, aber sie vermochten es einer geplagten Kriegerwitwe nicht anzutun, ihr und den Kindern die wichtigste Lebensader abzuschneiden. Es war beein-
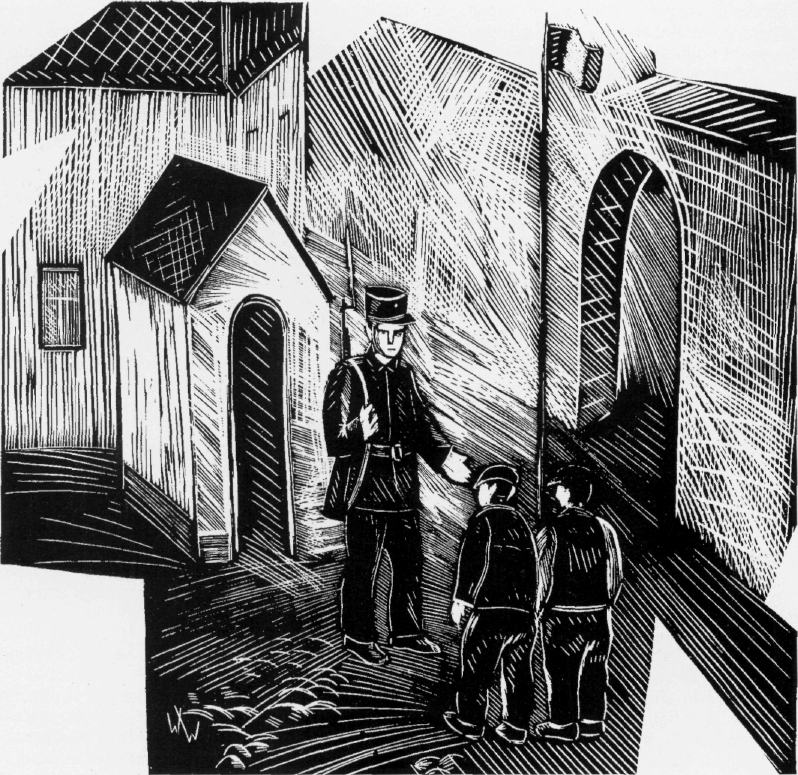
Französische Wachstation vor dem Hause Hunz am Burgaufgang in Daun: Ein Besatzungssoldat bewacht die Trikolore und achtet darauf, dass jeder Vorbeigehende sie grüßt. Linolschnitt: Walter Wilde, Daun
druckend, wie sorgfältig der Franzose die Abgabepflicht der einzelnen Bauern kontrollierte. Er interessierte sich nicht nur für das Abgabegut - in diesem Fall für die Rinder -, sondern kümmerte sich auch um die Eigentümer, und so entspann sich zwischen ihm, dem gewissenhaften, fließend deutsch sprechenden Besatzungssoldaten und meiner Mutter folgender Dialog: Franzose: »Hast du nur eine Kuh?«
Mutter: »Ja, hier die ist die einzige!« Franzose: »Wo ist dein Mann?« Mutter: »In Russland gefallen!« Franzose: »Dann nimm deine Kuh und geh' nach Haus!«
Mit Tränen in den Augen führte meine Mutter unsere HANS heim in ihren Stall. Die Bauern waren sprachlos. Soviel Verständnis hatte man zu jener Zeit bei deutschen Beschlagnahmern nicht alle Tage gefunden. Sie, die von den Franzosen zum Requirieren des Viehes in die Dörfer geschickt wurden, machten von ihre r Amtsgewalt nicht immer den rechten Gebrauch. Oft gebärdeten sie sich wichtigtuerisch, vor allem gegenüber Frauen, die des Schutzes ihrer Männer entbehrten. Persönliche Berührung, besser gesagt. Konflikte mit den Franzosen hatte ich nur ein einziges Mal. Das war in Daun. Dorthin fuhren wir - Kläre Jupp und ich - frühmorgens mit dem Zug und kamen spätabends zurück. An verschiedenen Stellen der Kreisstadt - zum Beispiel am »Franzosenhaus« gegenüber der Bürgermeisterei und bei der Schreinerei Hunz am Burgaufgang war die französische Fahne, die Trikolore, aufgerichtet. Diese musste man grüßen, das war Vorschrift, und es war öffentlich bekannt gemacht. Männer und Jungen hatten dabei ihre Mütze abzuziehen, so wie in Schillers »Wilhelm Teil" die Schwyzer dem Hut des Reichsvogts auf der Stange ihre Ehrerbietung zu erweisen hatten. Dass keiner das Herrschaflssymbol missachtete, dafür hatte der Wachposten zu sorgen, der, ein Gewehr übergeschultert, neben dem Fahnenmast stand. Niemand entging seinem strengen Blick.
Jupp und ich hatten massig Zeit. Unser Zug fuhr erst am Abend. Wir wollten uns nur die Haare schneiden lassen, sonst hatten wir nichts in Daun zu tun. Kreuz und quer schlenderten wir durch die Stadt, gingen die Burgfriedstraße hoch und erreichten schließlich die Passierstelle mit der Trikolore. Die Hände in den Taschen vergraben und die Mützen tief in die Gesichter gezogen, blieben wir stehen. Neugierig besahen wir uns die Fahne, das Kabäuschen und den Wachposten. Dieser machte ein grimmiges Gesicht, geriet zusehends in Wut, begann zu lamentieren und zeigte auf unsere Mützen. Aber wir verstanden nichts, weder Sprache noch Gestik. Auf einmal wurde es ihm zu bunt. Er rief seinen Kameraden herbei. Der war im Nu da, mit einem vollen Eimer Wasser, den er nach uns schüttete. Nun erst begriffen wir, dass wir etwas falsch gemacht hatten.
Am selben Tag begegneten wir in der Stadt einem Leichenzug. Unter den Trauergästen sahen wir viele Franzosen in Uniformen. Wir hörten Leute sagen, die Frau eines französischen Soldaten sei gestorben. Diesmal ließen wir uns zu nichts zwingen. Wir nahmen, wie wir das gelernt hatten, bereitwillig unsere Mützen ab und hielten sie solange in den Händen, bis der Zug vorüber war. Nachher begegneten wir einem älteren Jungen, den wir kannten. Es war der Jupp aus Gefeil. Er schimpfte auf die Franzosen und fluchte darüber, dass man ihn gezwungen hätte, beim Passieren des Trauerzuges seine Mütze vom Kopf zu nehmen..!
Aus: F. J. Ferber "Wie's daheim war-- Erzählungen aus dem Üßbachtal'' illustriert mit Linolschnitten von Walter Wilde, erscheint 1994 im Helios Verlag in Aachen