
Oben im Venn
Freddy Derwahl. Eupen
Am stärksten ist die Uneinnehmbarkeit, so als näherten sich irgendwo im Nebel Gebirgswind und Meeresweite. Zwar schlängeln sich die Siraßen gemächlich von Eupen nach Malmedy und Monschau, aber sie sind nur ein dünnes Band, letztlich wie alles hier oben: unsicher. Brächte der Herbststurm graue Wolken, fegte der wehende Schnee über die Flächen, es stünde schlecht um die Passage. Manchmal, in klaren Nächten, sieht man weit hinein ms Land, und am Horizont funkeln die Lichter von Lüttich und Aachen; aber zwischen dem warmen Bauch der Städte und der Höhe von Baraque Michel stehen die Wälder wie eine Mahnwache. Wer sich hindurch, hinauf begibt, sollte wissen, worauf er sich einlässt. Der Kreuze, der Schreckensgeschichten sind es genug. Kaum ein Jahr ohne panische Suchaktion und großes Bangen beim Einbruch der Dunkelheit. Denn sie bedeutet auch immer die hilflose Frist einer Nacht, weil die Forstwege plötzlich ins Leere stoßen und sich niemand mehr hineinwagt ins finstere Bodenlose. Fährt man an die Baumgrenzen heran, öffnen sich hinter den schwarzen Fichtenwänden die Schneisen in erschreckender Leere, und die Vermissten wandeln sich zu Gruselgestalten, deren Namen man nicht mehr in die Wucht dieser Stille hineinzurufen wagt.
So sehe ich sie zurückkehren, als es wieder Morgen wurde: Hände und Gesichter zerkratzt vom Dickicht, in dem sie irrten; gezeichnet von der Angst, erschöpft, durchnässt, tief verwirrt auch, weil man es nicht wahrhaben wollte, mitten in der zivilisierten Welt wie in Grimms Märchen verloren zugehen und erst noch einmal die Länge einer Nacht und die Tücke ihrer Geräusche lernen zu müssen, das Glucksen der Tümpel und Gräben, das leise Knacken des wechselnden Wildes, die Schreie der Raubvögel, das Heulen des Windes im dürren Geäst. Zur Winterzeit hüllt die Nacht sich hier in ein sibirisches Schweigen und die Hochebene wird noch gespenstiger. Eine Gruppe Lütticher Studenten tauchte erst nach vierundzwanzig Stünden der Spannung aus der Schneewüste wieder auf. Schluchzend, mit zerrissenen Anoraks und dazwischen, wie eine Gestalt des Wahnsinns, barfuss ein jünger Vietnamese.
Zur Schneeschmelze oder im Altweibersommer droht im ausgetrockneten Moor Feuer. Dann flattern auf Botrange und Ternell rote Fahnen. Aber auch diese Gefahr wird von den immer zahlreicheren Salontouristen unterschätzt, die dem Venn meist nur einen kürzen Besuch abstatten. Bricht ein Vennbrand aus, droht leicht eine Katastrophe, weil die Flammen nicht nur in die Wälder schlagen, sondern sich förmlich hineinfressen in das federnde, braune Erdreich aus Torfmoos, Glockenheide und Pfeifengras. Noch nach Tagen kann ein Windstoß im glimmenden Boden neue Brandherde entfachen. Manchmal sieht man aus der Ferne die roten Feuerwände wie eine Mauer am Horizont. Und in den Alarm mischt sich auch trotziger Kummer, weil intakte Wildnis und unberührte Natur für Jahrzehnte verloren gehen.
So ist das Hohe Venn zugleich eine Landschaft tückischer Schönheit und lockender Gefahren. Da, wo sich alles auf das Elementare reduziert, wirkt starke Macht. Sich ihr zu widersetzen, wäre ebenso töricht, wie sich ihr anbiedernd zu nähern. Sie bleibt immer die Überwältigende. Sei es lichtüberflutet in den Abschiedsfarben des Sommers, das Gras wogend wie Savanne, darüber blauer Himmel, zum Greifen tief. Oder so, wie an jenem trostlosen Nebelabend, als der Musiker Hubert Schoonbroodt unterhalb von Belle-Croix in den Tod raste. Viel Trauer um nie mehr gehörte Sonaten und Fugen. Das brutale, abrupte Ende eines »concerto grosso«. Und doch hat die Stille da oben, wo es geschah, alles aufgesaugt, aufgehoben, als sei es dennoch gut und nichts verloren.
Guillaume Apollinaire, der letzte Dichter, dessen Verse die französische Jugend noch auswendig kennt, hat sich in einer entscheidenden Phase seines Lebens in diese einsame Zone der »Fagne de Wallonie« vorgewagt. Der junge

Rurtal
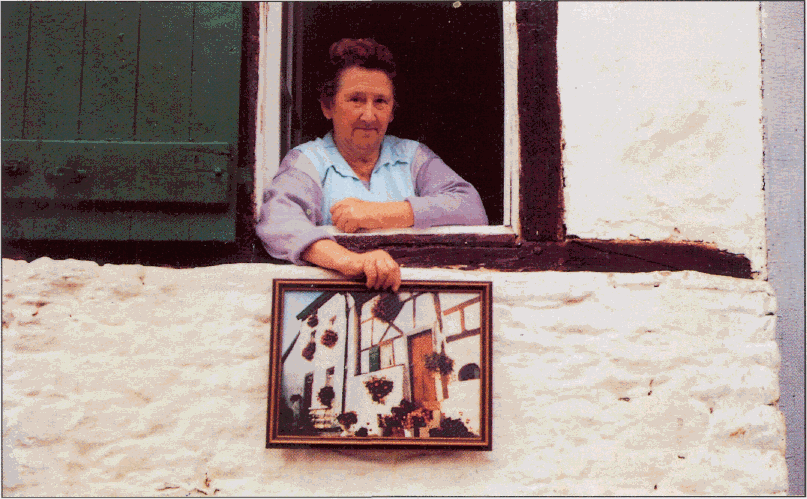
Gut »Born«: Lontzen
Poet aus dem Mittelmeerraum witterte plötzlich »den Norden, den Norden» und erkannte in den starken, gewundenen Bäumen, die sich gegen die Stürme stemmen, ein kräftiges Symbol des Lebens, das sich, »ä belles dents quand bruit le vent«, dem Tod in den Weg stellt. Und auch Raoul Ubac, der im preußischen Malmedy zunächst Rolf Ubach hieß, als Sohn des Friedensrichters aufwuchs und eine unglückliche Jugend verbrachte, verschwand immer wieder im Hohen Venn, bevor er in Paris zu malen begann und später, im Umfeld von Rene Magritte, Paul Eluard und Georges Queneau, zu einem der großen Künstler dieses Jahrhunderts aufstieg. Hier oben fand er, im Gegensatz zur provinziellen Enge von Schule und Elternhaus, die befreiende Weite, nach der er sich so sehnte. Betrachtet man seine Gemälde, wie »Ardennen» oder »Die späte Saison" und seine unverwechselbaren Schieferarbeiten, so wird klar, wie sehr der junge Mann bei seinen Auf brüchen die Landschaft seiner Heimat verstanden und verinnerlicht hat. Sie fliehend, nahm er sie für immer mit.
Schiefer ist das Urgestein des Vennmassivs, harter Quarzitfels oder weicher kambrischer Tonschiefer, der aus dieser Landschaft der Auflösungen, der gurgelnden Gräben, Brackwasser und Sümpfe wie ein Relikt der aufs Wesentliche reduzierten Mineralien- und Kristallwelt herausragt; weißlich geäderte Felsblöcke und Grauwacken, die erst tiefer, in den Tälern der Wildbäche, von Hillgranit und Malmedier Puddingstein abgelöst werden. Ubacs Werk wäre ohne Schiefer undenkbar. Für ihn ist es das Material primitiver Reinheit, dem er die Botschaft seiner zwischen Säufern und Prostituierten wiederentdeckten Religiosität einritzen konnte. Da geht es symbolhaft um »das Heilige-', das ihm weder im deprimierenden Moralismus seiner Jugend noch im verwegenen Spott des Surrealismus begegnet war, sondern, ganz unbewusst, in der Einsamkeit des Venns, das ihn zugleich faszinierte und erschreckte.
Solche Erfahrungen kann man sich nur erwandern. Und so gilt in diesen Bezirken der Abgeschiedenheit allein die Strenge mühsamen Gehens, das Abenteuer riskanter Suche nach dem immer entschwindenden Pfad, der zwischen tückisch leuchtenden Wasserlachen versickert, im verbrannten Wald von Noir Flohay wieder an Boden gewinnt, federleicht wird und bald im Wollgras unier öligen Flecken erneut versumpft. Auf Schritt und Tritt begegnen sich Schönheit und Tod. Hier ist zugleich der Ort, an dem die alten Sprach- und Landesgrenzen bis zur Unkenntlichkeit ineinander gleiten. Da mag hier und da, auf sicherem Boden, ein verwitterter Grenzstein, ein verkümmertes Hoheitszeichen stehen, aber es gehört zum mysteriösen Wesen dieser Landschaft, dass sie sich Grenzziehern, Landvermessern und Strategen immer souverän verweigert hat. So zuletzt während der Ardennenoffensive im Winter 1944, als das von Hitler persönliche befehligte Geheimunternehmen »Stoesser« scheiterte; die hinter der Front abgesetzten Fallschirmjäger unter Oberst von der Heydte vermochten im unwegsamen nächtlichen Gelände die anvisierte Passhöhe von Mont Rigi nicht zu besetzen.
Sprachen und Nationalitäten scheinen im Venn zur Farce degradiert. Gerät man einmal in den Bann der sich verlierenden Wege, vermag man nicht mehr zu sagen, wo das Große Moor die alte Vekee berührt, ob sich der Rotwasserbach an der Fagne Moupa oder Planeresses biegt oder ob sich noch ein Trampelpfad von Clefay hinauf nach Pannensterz windet. Und es wird völlig unerheblich, ob da Torfmoos, le sphaigne oder lu mosse aufleuchtet; ob Fieberklee, la violette des marais oder lu pore, die von Frau Loki Schmidt so liebevoll umhegten gelben Narzissen, flüchtig blühen. Selbst die Kreuze verlieren nach langem Wandern den Schrecken plötzlichen Todes und wandeln sich zu Wegmarken und Ankunftszeichen: Anders als die verzweifelten Verlobten Francois Reiff und Marie Solheid aus Xhoffraix, anders als der ermordete Eupener »Meyer« Thomas Dael oder der im Unwetter bei Botrange tödlich verunglückte Olivier Gazon aus Sourbrodt sind wir noch ein-maldavongekommen.
Bleibt nur die stille Botschaft all dieser Gedenkstätten, die mehr als anderswo etwas Endzeitliches vermitteln. So am Vennkreuz bei Raeren, wo eine Inschrift den Passanten daran erinnert, daß »Du bald in die Ewigkeit wanderst«, oder oben auf Reinartzhof, am alten Pilgerweg Aachen-Triere, wo ein Kreuz in der Hecke aufruft: »O Wanderer, sei eingedenk der Abgeschiedenen, die in dieser Einsamkeit gelebt haben.« Eine Urkunde der Reichsstadt Aachen aus dem Jahre 1338 deutete erstmals darauf hin, daß hier »im Walde am Reinhard" ein Einsiedler hauste, der Obdach und Stärkung gewährte und bei Nacht und Nebel zur Orientierung der Verirrten eine Glocke läutete. Ein Liebesdienst, der im Hohen Venn jahrhunderte lang gepflegt wurde; auf Baraque Michel, Alt Hattlich oder im Kloster Reichenstein.
Heute wird den Verlorenen keine Glocke mehr geläutet. In Notfällen sind Spürhunde, Raupenfahrzeuge und Hubschrauber im Einsatz, geht man mit Lautsprechern, Feuerlicht und Leuchtraketen zu Werke. Doch wundert es nicht, dass sich die Einsiedlertradition bis zum heutigen Tag in diesem Land rauher Schönheit gehalten hat. So etwa oberhalb der Ferme Libert in der renovierten Eremitage von Bernister, die der ehemalige Abt von Clervaux, Dom Jacques Winandy jahrelang bewohnte. Er war mit dem Dichtermönch Thomas Merton befreundet und hat lange Zeit in der Karibik neue Formen geistlichen Lebens erprobt, bevor er sich endgültig am Rande des Hohen Venns niederließ. Seine Erfahrungen sind dabei denen der Künstler, die hier Zuflucht suchten, nicht unähnlich: Wie Apollinaire zieht er die betörenden Farben der Wald- und Preiselbeeren dem Goldschrein der Abteiheiligen vor, und wie Ubac lernte er in dieser Einsamkeit, dass Heimat nicht etwas Geographisches ist, sondern ein Ort, der sich im Herzen der Menschen befindet.
An die Strenge der Klausuren erinnert auch das Naturparkzentrum Botrange, das mit viel Sensibilität in die Landschaft h i nein komponiert wurde. Hier stellt man sich der schwierigen Aufgabe, touristische Neugier mit den Bedürfnissen der Ökologie zu versöhnen. Ähnlich wie in der Bildungsstätte »Haus Ternell« oder im Forschungszentrum der Universität Lüttich auf Mont Rigi wird hier vor allem ein neues Umweltbewusstsein vermittelt, ohne dass diese noch intakte Landschaft, der Langläufer und Tagestouristen schon schwer genug zusetzen, nicht lebensfähig wäre. So entstanden der Wissenschaft, der Forstwirtschaft und den Künsten hier oben neue Aufgaben, Dabei können sie sich auf leuchtende Vorbilder vergangener Jahrhunderte berufen, wie die Botanikerin Marie-Anne Libert aus Malmedy, die 1830 ein
Standardwerk über die »Kryptogame Pflanzenwelt der Ardennen« veröffentlichte. Preußens Kronprinz Friedrich Wilhelm IV. empfing sie anlässlich seines Besuches in der wallonischen Enklave, während ihr der König selbst aus dem fernen Berlin goldenen Halsschmuck zukommen ließ und die entsprechende »Allerhöchste Kabinettsorder« vom 23. Januar 1834 eigenhändig mit »Frederic Guilleaume« unterzeichnete.
Das schwammige Hochplateau des Venns hat in unseren Tagen als riesiges Wasserreservoir zusätzliche energiepolitische Bedeutung erlangt. Die an seinen Ausläufern gelegenen Talsperren von Eupen, Gileppe, Robertville, Bütgenbach, Schwammenauel und Dreilägerbach spielen bei der Trinkwasserversorgung und Stromerzeugung eine Rolle, die weit über die Grenzen der Region hinausgeht. Kein Wunder, dass 1973 der in der belgischen Geschichte einzige deutschsprachige Staatssekretär Willy Schyns während seiner nur neunmonatigen Amtszeit ernsthaft weitere Stauseeprojekte ins Auge fasste oder der Eupener Senator Fred Evers im Herbst 1992 die »S p lege l "-Leser schmunzelnd mit dem Vorschlag zur Schaffung eines »Wasserscheichtums Ostbelgien« überraschte.
Aber das Hohe Venn als Forschungsobjekt, Freizeitpark oder politisches Versorgungsprogramm: Beginnen da nicht schon die Verirrungen? Das Eigentliche dieser Landschaft entzieht sich allen Versuchen der Vermarktung, der Nutzung, des Gefügigmachens. Noch herrschen hier Weite und Stille, noch das Unberechenbare. Pflanzen und Tiere beugen sich diesem Diktat intakter Natur, dem uralten Gesetz der Wildnis, rauh und sensibel, leicht störbar, doch im Gegenschlag von brutaler Gewalt. Wo Stille herrscht, wird vom Menschen Schweigen verlangt; wo Weite, Weitblick; wo Tiefe, Tiefgang; wo Leere, die Bereitschaft zur Einsamkeit. Manchmal scheint dann, als sei hier der existentielle Raum des Unnahbaren und Absichtslosen. Viel Schrecken, viel Faszination geht davon aus. So muss geschehen, was dem modernen Menschen am schwersten fällt; vor der Größe dieser Landschaft ganz klein zu werden.
Nur so ist sie zugänglich, erfassend und erschütternd.

Das Kreuz im Venn

Vennbahnstrecke im Rurtal

Goldgrasblüte
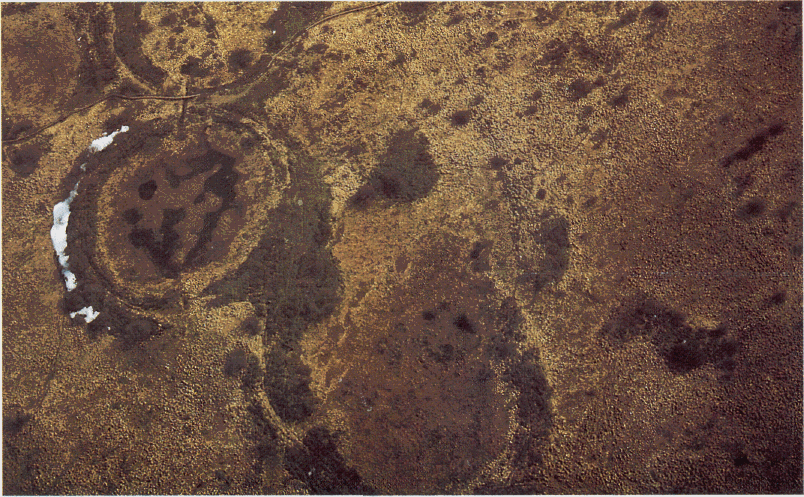
Vennlandschaft aus der Vogelperspektive