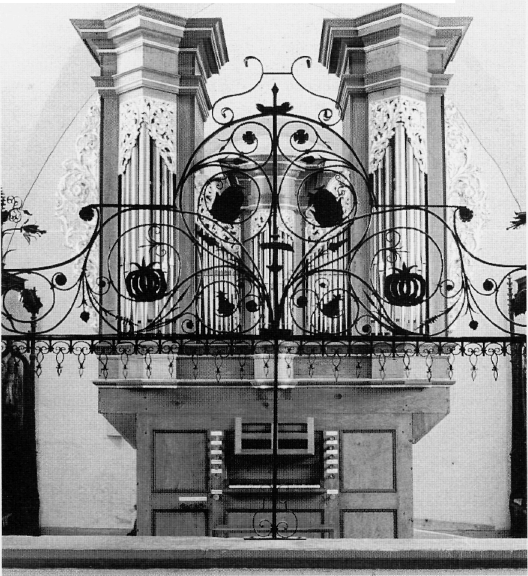
Wie weckt man eine »Königstochter«?
Zur Restaurierung der Balthasar-König-Orgel in Niederehe
Thomas Romes, Nohn
Wenn dieser kleine Bericht erscheint, wird das Instrument wieder seinen alten, prächtigen Klang in der ehrwürdigen Klosterkirche St. Leodegar entfalten. Nach langem Siechtum erklingt dann die Orgel des Balthasar König ("18. 6.1684116.12.1756) in alter Schönheit. Das zu den ältesten Instrumenten in Rheinland-Pfalz zählende Orgelwerk wird am 27. September durch den Trierer Domorganisten Josef Still wieder öffentlich zum Gotteslob erschallen.
Hier soll nun aufgezeigt werden, wie die eigentlichen Restaurierungsarbeiten vonstatten gingen - hat man doch selten die Gelegenheit, einem Instrumentenbauer bei einer solchen Arbeit über die Schulter zu blicken.
Die Orgel;
ein Gebrauchsgegenstand mit Abnutzungserscheinungen
Seit Anno 1715, also mehr als zweihundertdreiundachtzig Jahre (!), steht das Instrument auf der ehemaligen Nonnenempore in Niederehe. Eine Orgel hat - wie jede Maschine - eigentlich eine begrenzte Lebenserwartung. Was jahrhunderte lang bewegt wird, das verschleißt und wird abgenutzt. Zudem wandelte sich im Laufe der Zeit der Musikgeschmack, im 19. Jahrhundert wusste man mit einer Barockorgel nicht mehr viel anzufangen. Viele Register (= Pfeifengruppen, die nach Klangeigenschaften zusammengefasst sind) wurden dem Zeitgeist geopfert, da sie als allzu weltlich und für die Kirche unschicklich erschienen. Auch in unserem Jahrhundert erhielt das Werk nicht die Pflege, die einer solchen Denkmalorgel zugestanden hätte. Vor der Restaurierung befand sich die Orgel in solch schlechtem Zustand, dass man sich fragt, wie es Organist Christoph Fischbach fertig brachte, überhaupt noch etwas Klingendes aus der vernachlässigten »Choralpumpe« herauszulocken. Es war ein langer Weg, bis die Restaurierungsarbeiten an den Oberbettinger Orgelbaumeister Hubert Fasen vergeben werden konnten. Dem Engagement des Orgelliebhabers Klaus Kemp ist es zu verdanken, dass das Unternehmen Orgelrestaurierung auch finanziell abgesichert wurde, lagen doch die veranschlagten Kosten bei etwa 280.000 DM. Mit einer
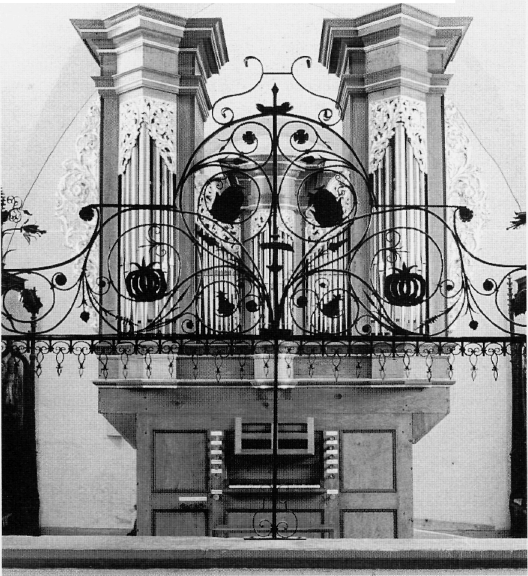
Fotos: Orgelbauer Fasen
einmaligen Aktion »Kauf Dir einen Ton«, die gar in Rundfunk und Fernsehen Beachtung fand und der Veranstaltung einer eigenen Konzertreihe, (»Niedereher Klosterkonzerte«) hat er das Fundament für die Wiederherstellung dieses kostbaren Kulturerbes gelegt.
Wie restauriert und rekonstruiert man eine Barockorgel?
Zu Beginn eines solchen Unternehmens stehen Gutachten. Die Stellen kirchlicher und staatlicher Denkmalpflege, sowie die Orgelsachverständigen, untersuchen den Zustand und erarbeiten wissenschaftliche Befunde zur ursprünglichen Gestalt des Instrumentes. Diese Vorgaben setzen die Leitlinien, nach denen sich der Orgelbauer orientieren muss. Neben dem Sachverständigen des Bistums, Domorganist Josef Still, war Herr Dr. Meister, ein Experte für König-Orgeln, ständiger Begleiter der Restaurierungsarbeiten. An den Orgelbauer werden hohe Anforderungen gestellt; er muss sein Kunsthandwerk streng nach alten Arbeitstechniken ausführen. Seine Aufgabe besteht darin, so behutsam vorzugehen, dass sich seine Rekonstruktionen harmonisch in das alte Werk einfügen. Der Orgelrestaurator muss sich gedanklich zurückversetzen, eigene Intentionen haben hinter den Vorstellungen des Erbauers zurückzutreten. Viele verloren gegangene Teile, sei es beim Gehäuse, dem Pfeifenwerk, den mechanischen Trakturen (= die überwiegend aus Holz gefertigten Teile, mit denen die Bewegungen der Tastaturen an die Ventile, unter den Pfeifen, weitergegeben werden), den Tastaturen oder der Gebläseanlage, galt es behutsam wieder einzufügen. Nirgends darf ein Bruch zwischen Alt und Neu hervortreten.
An Ort und Stelle wurde der Ist-Zustand aufgenommen, das Instrument vermessen, katalogisiert und dann Stück für Stück abgetragen und in die Werkstatt gebracht. Die aufwendigen Schnitzereien, die »Ohren« an den Seitentürmen und die »Schleierbretter« oberhalb der Pfeifenenden, wurden dann vom Hausorganisten und Bildhauer Christoph Fischbach wiederhergestellt und vergoldet. Das Gehäuse wurde in der Werkstatt des Orgelbauers überarbeitet, manches war so morsch und verwurmt, dass es ersetzt werden musste. Die rückwärtigen Gehäusetüren, die den Zugriff für Stimmung und Wartung freigeben, erhielten ihre alten, kunstvollen Beschläge wieder. Neben dem Gehäuse wurden die originalen Windladen und die Trakturen für das Manual (= Handklaviatur) und das Pedal überarbeitet und in den Originalzustand zurückversetzt. Windladen sind Eichenholzkästen mit einem komplizierten System von Bohrungen und Verführungen, in denen die Luft - der Orgelbauer spricht vom Wind - ihren Weg zu den einzelnen Pfeifen findet. Nachdem diese Teile sorgsam wiederhergestellt waren, wurde die Orgel - mit Ausnahme des Pfeifenwerkes - in der Oberbettinger Werkstatt probeweise aufgerichtet. Erst dann erfolgte der Wiederaufbau am ursprünglichen Standort auf der ehemaligen Nonnenempore der Klosterkirche. Zuvor hatten freiwillige Helfer dort einen Parkettboden verlegt. Die Orgel wurde näher an die Emporenbrüstung herangerückt, so wird der optische Eindruck verbessert, wenn auch noch das ehemalige Chorgitter die Sicht auf das Instrument behindert. Eine Forderung der Denkmalpflege war die Rekonstruktion einer mechanischen Balganlage, die unabhängig von einem elektrischen Gebläse eingerichtet wurde. Hubert Fasen und seine Mitarbeiter bauten diese Winderzeuger historischen Vorbildern nach, diese Blasebälge bestehen aus Holzplatten, die mit Schafleder verbunden und abgedichtet sind. Zwei große Keilbälge stehen nun, übereinander angeordnet, hinter dem Gehäuse und versorgen - wenn ein Balgtreter zur Hand ist - die Orgel mit dem nötigen Wind. Daran schließt sich, direkt vor der Fensterrosette, das Pedalwerk (das sind große, tiefklingende Pfeifen, die mit der Fußtastatur angespielt werden) an. Da diese Balganlage nicht umbaut ist, hat man nun die Gelegenheit, die Arbeit des Balgtreters, des sogenannten Kaikanten, zu verfolgen. Das Auf und Ab der großen Blasebälge wirkt wie die Bewegung einer überdimensionalen Lunge, die dem Instrument ihren Lebensgeist einhaucht. Die Hand- und Pedalklaviaturen mussten ebenfalls im Sinne des Erbauers neu erstellt werden. Mitte Mai 1998 begann der Wiedereinbau des Pfeifenwerkes. Die originalen Prospektpfeifen, das sind die Pfeifen im »Gesicht« des Instrumentes, wurden sorgsam ausgebeult und wieder blank poliert. Mittels dieser originalen Pfeifen konnte das Instrument auch die ursprüngliche Stimmung wiedererhalten. Entgegen der heutigen Praxis einer »gleichstufigen« Temperatur, ist hier nun eine Stimmung rekonstruiert, mit der Balthasar König die gebräuchlichsten Tonarten besonders rein und strahlend ausstattete, auf Kosten entlegener Tongeschlechter, die bei manchen Akkorden ein »Wolfsgeheul« erzeugen, wie es die Alten nannten1. Von den insgesamt 12 Registern, das sind die unterschiedlichen Pfeifengruppen die sich in Klangfarbe und Bauart unterscheiden, mußten sechs rekonstruiert werden. Für den Nachbau des Registers Coppel, einer Stimme die in der süddeutschen Heimat Balthasar Königs häufig vorkommt, reiste Hubert Fasen eigens nach Bayern. In einer Orgel, die Balthasars Bruder Caspar (wohl auch sein Lehrmeister) gebaut hatte, konnte der Orgelbauer dieses Register studieren.
Wir finden also jetzt eine detailgetreue Kopie dieser bayerischen Stimme in unserer Vulkaneifel! Neben alten Arbeitstechniken werden nur Materialien verwendet die zur Entstehungszeit des Instrumentes gebräuchlich waren. Knochenleim, verschiedene einheimische Hölzer, Schafleder, Zinn, Blei, Eisen und Messing. Zum Abdichten und Verkleben verwendete man damals auch Pergamentstreifen aus alten Kirchenbüchern (!). Aluminium, Stahl, Plastik oder Sperrholz sind bei der Restaurierung absolutes Tabu. Der Oberbettinger Meister legt wert auf diese soliden und bewährten Werkstoffe und die überkommenen Fertigungstechniken, gilt der Orgelbau des Barocks doch als unübertroffenes Vorbild jedes anspruchsvollen Orgelbauers. Die Namen Silbermann, Riepp, Stumm oder König stehen für dieses hohe Niveau, das der deutsche Orgelbau, im 18. Jahrhundert erreicht hatte. Die in der Werkstatt vorintonierten Pfeifen wurden nach und nach wieder eingebaut und solange behandelt, bis jeder Ton seine richtige Höhe, Ansprache, Lautstärke und Charakteristik hervorbrachte. Eine Arbeit, die dem Meister eine gehörige Portion Geduld und Beharrlichkeit abverlangt, musste doch jeder Pfeife, die richtigen »Flötentöne« beigebracht werden. Der Intonateur ruht nicht, bis alle 711 Pfeifen stimmen und alle Register miteinander harmonieren. Nun erschallen die Klänge der alten Barockorgel wieder. Für viele Gottesdienstbesucher, die den Zustand vor den Arbeiten kannten, wird der »neue Urklang« ge-
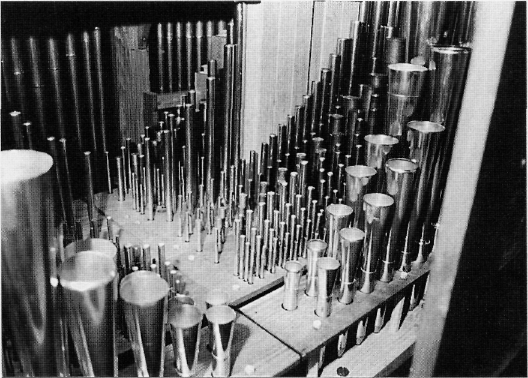
wöhnungsbedürftig sein. Das Register Solsena mit seinem dunklen, hornartigen Timbre, das spritzig-helle Kornett, die silbernstrahlende Mixtur und vor allem die kräftigschmetternden Trompeten lassen das Klangerlebnis »Anno 1715« lebendig werden. Das Barockzeitalter liebte dieses prächtige, auf Repräsentation ausgerichtete, Klangbild. Renommierte Organisten haben bereits Konzerte auf unserem barocken Kleinod angekündigt. Zwei CD-Aufnahmen, eingespielt von Kantor Josef P. Eich und Domorganist Josef Still, zeugen von der Wertschätzung des Instrumentes. Auch die Gesellschaft der Orgelfreunde, die im August 1998 ihre internationale Orgeltagung in Trier beging, richtete ihr Augenmerk auf die Niedereher Orgel. Im Rahmen dieser Veranstaltung besuchten Orgelkenner, Orgelsachverständige, Organisten, Orgelbauer und Liebhaber die ehemalige Klosterkirche. Der Restaurierungsarbeit des heimischen Orgelbauers wurde dabei Anerkennung zuteil. Der Kreis Daun hat nun ein einmaliges Kulturerbe zurückerhalten. Neben den anderen berühmten König-Orgeln der Eifel in Aremberg, Beilstein, Schleiden, Steinfeld und Wollmerath zeigt sich die Balthasar-König-Orgel in Niederehe wieder würdig als echtes Königskind. Ganz im Sinne Wolfgang Amadeus Mozarts, von dem der eigentümliche Ausspruch »die Orgel ist doch in meinen Augen und Ohren der König der Instrumente« stammt.
Hinweis:
CD-Einspielungen sind beim kath. Pfarramt Niederehe erhältlich:
Josef P. Eich: »von d'Andrieu bis Zipoli« - Werke der Renaissance und des Barocks
Joseph Still: »Die Balthasar-König-Orgel zu Niederehe« - mit umfangreichem Begleitheft zur Restaurierung
Erst Königs Zeitgenosse Joh. Sebastian Bach hat im »wohltemperierten Ciavier« alle Tonarten für die Praxis erschlossen. Viele Orgelbauer behielten aber ihre konservative Stimmungsweise bei. Bach soll gar absichtlich in entlegenen Tonarten gespielt haben, um so den berühmten Orgelbauer Gottfried Silbermann zu foppen, der wie Balthasar König an der alten »Temperatur« festhielt.