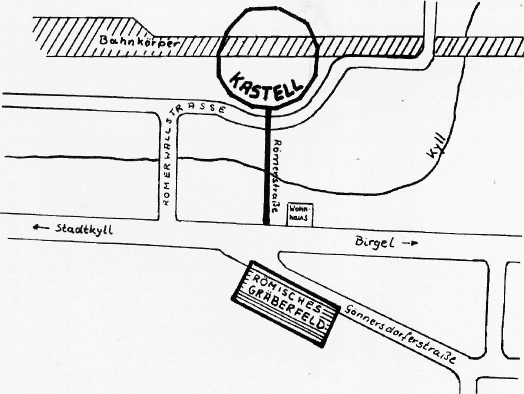
Die Welt der Toten
Bestattung in alter und neuer Zeit
Hubert Pitzen, Stadtkyll
Wer von uns verspürt beim nächtlichen Überqueren eines Friedhofes nicht ein Gruseln und ist froh, den Ort des Todes mit Schaudern und Gänsehaut schnellstens zu verlassen. Meinte man nicht Gespenster gesehen zu haben? Der Tod war schon immer ein furchterregender Zustand, da man nicht glauben mochte, mit ihm sei alles vorbei. Trotz heutiger Rationalität lässt uns unser Unwissen über das »Danach« an die Existenz übernatürlicher Mächte glauben. Man dachte sich ein Weiterleben der Verstorbenen oder deren Seelen entweder im Jenseits, im Grab oder in einer anderen Gestalt.
Unser heutiges Beerdigungszeremoniell beweist, dass wir unsere Toten symbolisch in eine nachfolgende Welt, in ein jenseitiges Leben entlassen. Wir folgen damit einem Kult unserer Vorfahren, der seit etwa 50000 bis 70000 Jahren besteht. Um so mehr werden wir auf den Boden der Realität zurückgeholt, wenn wir Zeitungsberichte über »neue Wege zu Bestattungen« lesen. Seit 1994 werden die Toten der Gemeinde Kirchweiler in einem Grabkammersystem beigesetzt. Viele Gemeinden stehen in den letzten Jahren vor dem Problem der Verwesungsmüdigkeit der Böden.
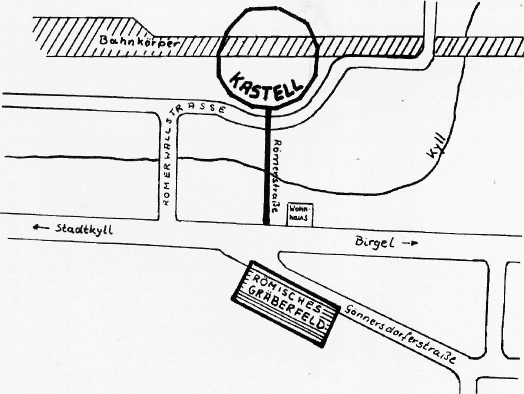
Die Lage des römischen Gräberfeldes außerhalb des Kastells Icorigium (Jünkerath). Quelle: Zeichnung Uwe Klug
Der Erdboden kann durch seine Zusammensetzung den Verwesungsprozess nicht mehr umsetzen. Liegezeiten von 30 Jahren sind keine Seltenheit und schaffen somit Platzprobleme. Austausch von Grabaushub kann das Problem kaum beseitigen. Da die Gemeinde Kirchweiler kein Land für eine Neuanlage eines Friedhofes besaß, fand man das System der wiederverwertbaren Grabkammern. Der »Trierische Volksfreund« berichtete:
»Die Kammern, die aus Stahlbeton sind, haben ein Maß von 2,35 Meter und sind 1,48 Meter hoch. Zusätzliche 40 Zentimeter Humus darauf lassen Raum für eine natürliche und individuelle Grabgestaltung und lassen nichts von der darunter liegenden Grabkammer erahnen. Mit Einbau kostet eine Kammer 4400 Mark.f...] Durch einen aeroben Verwesungsprozess bleibt das Boden- und Grundwasser von Leichengiften frei, Aktiv-Kohle-Filter verhindern, dass Geruchsstoffe nach oben dringen und mit Hilfe einer Tiefen-Dränage wird Stauwasser in einen Sickerschacht abgeführt. Entgegen den Empfehlungen des Herstellers, der eine Ruhefrist von 12 Jahren vorgibt, hat das Gesundheitsamt Daun eine Ruhezeit von 20 Jahren vorgeschlagen [.'..] Untersu-chungen der Herstellerfirma haben jedoch bereits nach gut zwei Jahren Liegezeit eine fast abgeschlossene Verwesung ergeben.«
In der Kirchweiler Bevölkerung stieß die »individuelle Verwesungsmaschine« teilweise auf Skepsis. Heute sind die Kirchweiler, wie es hieß, »angenehm überrascht von dem System«.
Blicken wir einmal in die Geschichte der Totenbestattung zurück. Bereits vor 50000 bis 70 000 Jahren versuchte der Mensch, die jenseitigen Mächte durch Grabbeigaben friedlich zu stimmen. In Neandertaler-Gräbern fanden sich zum Beispiel Blumengebinde. Wer anders als finstere Mächte waren verantwortlich für Naturkatastrophen oder den Tod. Totenkult hatte also zunächst die Aufgabe, die unsichtbaren Götter zu besänftigen.
In der frühen Bronzezeit (um 2 000 v. Chr.) bestatteten die Menschen ihre Toten in Flachgräbern. Auf der Seite liegend, mit angezogenen Beinen und vor der Brust verschränkten Armen, bettete man die Leiche zur letzten Ruhe. Der Schädel ruhte auf einem »Steinkissen«, der Körper war von einer Steinreihe umrahmt. Diese Hockstellung hat zu vielen Spekulationen Anlass gegeben, Forscher nahmen an, dass man den Toten die Beine an den Oberkörper festgebunden habe, damit sie sich nicht aus dem Grab entfernen und somit wiederkehren konnten. Andere glaubten, man habe die Leichen in eine Schlafstellung

Die Margarethenkapelle auf dem Stadtkyller Friedhof wird als Leichenhalle benutzt. Friedhofsordnungen reglementieren heute im Gegensatz zu früheren Zeiten das Friedhofsgeschehen.
bringen wollen. Ebenso kam die Vermutung auf, Platzgründe hätten eine Rolle gespielt. Eher zutreffend ist die Spekulation, die Hockstellung ahme die Embryonalstellung nach, in der der Mensch der »Mutter Erde« zurückgegeben werden sollte. Die Leiche wurde nach Osten ausgerichtet, um sie mit dem alltäglichen Erscheinen der Sonne in Zusammenhang zu bringen. An Grabbeigaben fand man Nahrungsmittel, Schmuck und Waffen, die dem Toten für mögliche Vorkommnisse auf seinem Weg ins Jenseits dienten. Alltagsbeigaben beweisen, dass man an ein Weiterleben nach dem Tode glaubte und dass der Verstorbene seine frühere Stellung beibehielt.
In der mittleren Bronzezeit (seit 1500 v. Chr.) kamen Hügelgräber »in Mode«. Hohe Erdaufschüttungen bedeckten den Baum- und Bohlensarg, in dem die Leiche in Rückenlage gebettet war. Ein Steinkreis umgab den Hügel, womit man die jenseitige und diesseitige Welt abgrenzte. Möglicherweise trat somit wiederum die Furcht vor der Wiederkehr der Toten symbolisch zu Tage. Größere Hügel mit vielfältigen Beigaben kennzeichneten den Reichtum und die soziale Stellung des Verstorbenen. Nur die gewaltigen Erdhügel sind erhalten geblieben, während die Gräber der einfachen Menschen im Laufe der Jahrhunderte zerfielen und verschwanden. War bisher die Skelettbestattung vorherrschend, ging man am Ende der mittleren Bronzezeit (ab 1300 v. Chr.) dazu über, den Leichnam zu verbrennen. Der Tote wurde auf einem Scheiterhaufen verbrannt. Die übrig gebliebenen Knochenteile bestattete

Die aufgeklärte Gesellschaft stellte den Tod als »sanften Schlaf« dar. Grabmal auf dem alten Glaadter Kirchhof.
man in einer Urne. Diese Begräbnispraxis gab einer ganzen Epoche ihren Namen: »Urnenfelderkultur«. Hatte diese Bestattungsart ihre Begründung in einer veränderten religiösen Anschauung? Möglicherweise schuf man gegenüber der Rückkehrangst einen Abwehrmechanismus. Jedenfalls war man der Meinung, dass sich die Seele vom Körper trennte und diese im Jenseits weiterlebte.
Auch in der folgenden Eisenzeit (mittlere Hallsteinzeit 8. bis 7. Jh. v. Chr.) wurde die Verbrennung der Toten praktiziert. Aus dieser Zeit fanden sich in den Mayener Steingruben viele Gräber, zum Teil unter Hügeln, zum Teil in ebener Erde. Die Urnen erreichten einen Durchmesser von 80 Zentimeter bei einer Höhe von 60 bis 65 Zentimeter. Außer Leichenbrand fanden sich in ihnen kleinere Urnen, Teller und Becher und Reste von Salz. Hochgestellte Personen erhielten ein eigenes hölzernes Grabhaus. Ein mächtiger Erdhügel bedeckte die Totenstätte. Beigaben bestanden aus Bronzeschmuck, Pferdegeschirr oder sogar einem Wagen, auf den die Leiche gebettet war. Aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. findet man keltische Gräber entlang der Römerstraße Neuwieder Becken -Kelberg - Jünkerath. Da Skelett- und Urnenbestattung zu Tage trat, liegt der Schluss einer ansässigen Mischbevölkerung nahe. Die Urnen lagen nur wenig unter der Oberfläche, bedeckt mit einem Hügel aus lockerer Erde. Bei Skelettbestattung legte man ein Tongefäß an Kopf und Füße der Leiche.
Die seit dem dritten vorchristlichen Jahrhundert ins Rheinland vorstoßenden Germanen übten Brandbestattung ohne Grabhügel in etwa 40 bis 50 Zentimeter Tiefe aus. Oft ist die Urne mit einer Schüssel bedeckt. Als Beigaben fanden sich Waffen, Schildbuckel, Lanzen und Messer. In der römischen Zeit (1. bis 4. Jh. n. Chr.) setzte sich die Brandbestattung fort. Die römischen Begräbnisstätten lagen außerhalb der Siedlungen, da nach römischer Ansicht die »Wohnungen« der Lebenden und Toten getrennt sein mussten. So fand man 1961 in Jünkerath die römische Begräbnisstätte mehrere hundert Meter von der Siedlung »Icorigium« entfernt. In den 20 Gräbern kamen Urnen, Ton- und Glasgefäße zum Vorschein. Allgemein herrschte in den ersten Jahrhunderten der Römerherrschaft ein reger Handel mit dem Mittelmeerraum, so dass man eine Fülle von Sigillata- und Bronzegegenständen fand. Oftmals legten die Römer Grabkammern an und schmückten sie mit Steindenkmälern.
Die Urnen wiesen teilweise an der Seite ein gebohrtes Loch auf. Ein Grund hierfür liegt möglicherweise in der römischen Mythologie. Vom 11. bis 13. Mai feierten die Römer die Lemura. Sie glauben, dass an diesen Tagen die Seelen der Toten als Schreckgespenster die Gräber verließen. Am letzten Tag des Totenfestes (21. Februar) brachte man Speise und Trank zu den Gräbern, was darauf schließen lässt, dass man an ein Weiterleben der Seele glaubte. Handwerksspezifische Beigaben wie Säge oder ein Fläschchen von einem Arzt waren keine Seltenheit. Die Brandbestattung lässt sich in der Eifel bis zur Zeit des Kaisers Konstantin verfolgen (4. Jh. n. Chr.).
Unter dem Einfluss des Christentums fand in der ausgehenden Antike die Bestattung der Toten mit Bekleidung und schweren Nagelschuhen statt. Im Rheinland gefertigte Gläser sowie Tongefäße, Bronzeschnallen und Münzen gab man mit ins Grab. Die Franken bestatteten seit dem fünften Jahrhundert ihre Toten in Reihengräbern, oftmals ohne Sarg. Männer erhielten Waffen, Frauen Schmuck als Beigabe. Doch mit der Ausbreitung des Christentums nahm die Tradition der Beigaben ab, nachdem Karl der Große diesen als heidnisch angesehenen Brauch verboten hatte. Über l 000 Jahre fanden die Toten inmitten des Dorfes an der Kirche ihre letzte Ruhe. Lebende und Tote waren räumlich nicht voneinander getrennt. Doch diese Aussage galt nicht für Mitglieder anderer Konfessionen, Selbstmörder, Hingerichtete, Dirnen und ungetaufte Kinder. Ihnen verwehrte die Kirche nicht nur die Begräbnisrituale, sondern man verscharrte die Geächteten außerhalb der Burgfriedensgrenze, um ihre Existenz für immer auszulöschen.
Die ständische Gesellschaft bestimmte bessere und schlechtere Grabplätze. Am begehrtesten waren Grabstellen an der Kirchenmauer oder in der Kirche. Diese konnten aber nur von Geistlichen beansprucht werden. Die Mehrheit der Bevölkerung wurde auf dem Kirchhof beigesetzt. Bis zum 17. Jahrhundert vergrub man die Leichen wahllos, ohne jegliches Grabmal, so dass die Friedhöfe kahl und ungepflegt wirkten. Die Ruhezeit war kurz. Nach wenigen Jahren grub man die Knochenreste aus und schichtete sie in dem der Kirche angeschlossenen Beinhaus auf. Makaber erscheint es heute, wenn Regengüsse die nicht tief genug vergrabenen Leichen ausschwemmten. Schon im 17. Jahrhundert führte die Übersättigung des Bodens mit Leichengiften dazu, dass halbverweste Leichenteile zum Vorschein kamen. Auf Friedhöfen und in Kirchen sammelten sich Verwesungsgerüche, die aber als etwas Natürliches angesehen wurden.
Doch im 18. Jahrhundert entwickelte sich Abscheu vor dem Tod. Verwesungsgerüche empfand man zunehmend als Belästigung. Zudem stufte die Chemie die Beerdigungspraxis als gesundheitsschädlich ein. So entstand die Forderung, die Toten außerhalb des Ortes zu beerdigen. Die Friedhöfe entwickelten sich nun zu Orten der Kultur und Natur. Die Darstellung des Todes erfuhr eine Änderung, wobei er nicht mehr als Skelett, sondern als jugendlicher Genius personifiziert wurde. Die aufgeklärte Gesellschaft versinnbildlichte den Tod auch als »sanften Schlaf« (Schlaf=Bruder des Todes). Im 19. Jahrhundert ging das Friedhofswesen von der Kirche in die Verfügungsgewalt der Zivilgemeinden über. Außerhalb der Städte wählten die Ratsherren Grundstücke aus, die den Verwesungsprozess beschleunigten. Ebenso fand die Hauptwindrichtung Berücksichtigung, um den Verwesungsgeruch zu verhindem. Einzelbestattung garantierte eine schnelle Verwesung. Nun hatte jeder Anspruch auf eine eigene Begräbnisstätte, was der Idee der Rechtsgleichheit entsprach. Zwei Gräbertypen kristallisierten sich heraus: Einerseits die Reihengräber des größten Teils der Bevölkerung, deren Ruhezeit mit der Verwesungszeit gleichgesetzt wurde. Die Friedhofsverwaltung registrierte den Begräbnisort jedes Toten mit einer Nummer. Selten waren Holzkreuze, so dass sich Gräber kaum zu Erinnerungsstätten entwickeln konnten. Andererseits gab es Einzel- oder Familiengräber, die auf Friedhofsdauer gekauft werden konnten. Steinerne Monumente mit eingemeißelten Namen erinnerten an den Verstorbenen. Die Gräber der reichen Bürger verlagerten sich allmählich an die Peripherie der Friedhofsanlage. Vielfältige Formen des Präsenthaltens der Person entwickelten sich. Stelen, Obelisken, Säulen, Pyramiden, Sarkophage und Kreuze hielten die Erinnerung an die Toten wach. Am Grab sitzende Frauenfiguren verkörperten die Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe. Der Tod galt als Zustand völliger Ruhe und Harmonie.
Jedenfalls erstaunt es, dass Gräberpflege noch nicht üblich und Gräber keineswegs regelmäßig besucht wurden. Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam eine gärtnerische Gestaltung der Friedhöfe auf. Auf den Grabsteinen hielten Emaille- und Porzellanfotos das Bild des Toten in Erinnerung. Nun setzte sich auch bei den Toten der Mittel- und Unterschicht das Holzkreuz mit Namen und Lebensdaten durch. Gusseiserne Kreuze kamen durch ihre Serienfertigung zu großer Verbreitung. Marmor- und Granitsteine lösten dann die gusseisernen Kreuze ab. Die Grabstätten entwickelten sich je nach Individualität; pathetische Trauer auf der einen Seite - stilles Gedenken auf der anderen. Die Grabstätten wurden zu privaten »Grundstücken«. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kann man die Friedhöfe als schlichte Totengedenkstätten bezeichnen. In der Massengesellschaft schwand die Individualität. Die Friedhöfe ähnelten schablonenhaften Gräberfeldern. Die Bürokratie schrieb die »Ewigkeit« auf etwa 30 Jahre fest.
Quellennachweis:
Berg M., Der Glaube an das Jenseits. In: Geschichte mit Pfiff, 2/2000
Gassen, H., Neuer Weg zu Bestattungen hat sich bewährt. In: Trierischer Volksfreund v. 13. 1.2000 Hörter R, Die Totenbestattung in alter Zeit mit besonderer Berücksichtigung der Vorder- und Hocheifel. In: Eifelvereinsblatt 1922
Treichel E., Imaginäre Totenstädte. In: Damals 1/2000