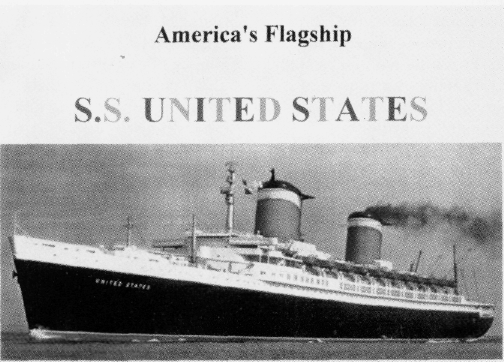
Auswandern nach Amerika, ganz früher und in den Fünfzigerjahren
Wilma Herzog, Gerolstein
Schaut man sich einen Katasterauszug heimatlicher Gemarkungen des Kreises Daun aus dem 19. Jahrhundert an, fallen die Landzerstückelungen auf, die durch wiederholte Erbteilung entstanden waren. Handtuchschmal, ungeeignet, vom Ertrag darauf eine Familie satt zu machen, zu einer Zeit, als der Lebensunterhalt noch von der Landwirtschaft bestritten werden musste. Hier sehen wir einen der Gründe, warum früher Eifeler ihre Heimat oft schweren Herzens verlassen haben. Zunächst waren Auswandererziele Ost- und Südost-Europa, der Balkan, Polen und die Ukraine, die Schwarzmeer- und Wolgaregion Schiere Not durch Missernten, Steuerlast und allgemeine Aussichtslosigkeit trieben sie fort Aber auch in Südamerika glaubten die Menschen im 19 Jahrhundert ein Auskommen zu finden, eine Chance zum Überleben.
Dann lockte Amerika Zur Besiedlung riesiger Weiten suchte es neue Siedler in der Alten Welt Das Land war äußerst preiswert zu haben Auswanderer berichteten m ihren Briefen darüber den noch Darbenden m der Heimat, und das überzeugte viele, alle Habe zu verkaufen, ihr Bündel zu schnüren und die wochenlange, oft riskante Fahrt auf einem Schiff auf sich zu nehmen. Außerdem zog dieses Land jene jungen Männer an, die dem strengen Militärdienst in Deutschland entkommen wollten. Mein Onkel Jakob Eis war Pazifist, er wanderte darum in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts nach Amerika aus. Eisenbahnlinien, die jetzt das Land vom Atlantik bis zum Pazifik erschließen sollten, versprachen Auswanderern, die körperliche Arbeit nicht scheuten, auch wenn sie die englische Sprache nicht sofort beherrschten, sofort einen geregelten guten Verdienst. Aber auch religiöse Verfolgung trieb Menschen nach Amerika, das die Möglichkeit bot, dort endlich ihre Religion frei auszuüben. Es gingen die Hutterer, die Harmonisten, Baptisten, Lutheraner und Reformierte und viele andere religiöse Gemeinschaften nach Amerika. Mitglieder aufgelöster Orden durch Bismarcks Kulturkampf mit dem Vatikan (1871-1886) kamen Rettung suchend nach Amerika. Das waren Menschen mit festem Glauben und hohen Idealen. Sie gingen Deutschland für immer verloren und bereicherten die Neue Welt. Wie rund 200 Jahre zuvor die 13 Mennoniten-Familien aus Krefeld. Sie landeten am 6. Oktober 1683 mit der Concord, gerührt von Franz Daniel Pastorius. Diese deutschen Pietisten siedelten sich auf Einladung des Gründers William Penn, in dem von ihm gegründeten und nach ihm benannten Staat Pennsylva-nien an. Sie sind die Vorfahren der bis heute dort lebenden großen Gemeinschaft der so genannten »Pennsylvania Dutch«, die ihren Dialekt, ihr Brauchtum und die alten, übers Meer mitgebrachten Ideale bis heute bewahrten. Diesen Mennoniten und Quäkern, die Krieg und darum jeglichen Militärdienst ablehnen, war unsere Schulspeisung und die aller erste medizinische Hilfe nach dem verheerenden Zweiten Weltkrieg zu verdanken. Das blieb meist unbekannt. Man sagte, die Amerikaner halfen uns. Doch waren es diese Religionsgemeinschaften,
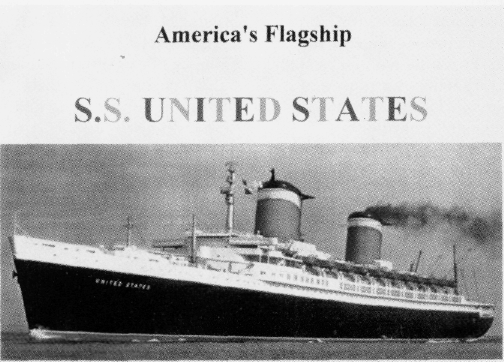
die aus zutiefst christlicher Gesinnung uns spontan in der größten Not im zerbombten Deutschland beistanden.
In der Volksschule erfuhren wir Ende der 1940er Jahre erstmals über den Deutschen Carl Schurz, der als politischer Dissident nach Amerika kam, als General im Bürgerkrieg auf Seiten der Union kämpfte und schließlich Verbündeter des amerikanischen Präsidenten Abraham Lincoln wurde. Er war Senator von Missouri und wurde auch als Sekretär des Inneren von den Amerikanern hoch geschätzt. Das machte damals immensen Eindruck auf uns Schüler. Denn wir lernten zunehmend, in welch schlechtem Ruf wir Deutsche in der Welt standen. Allmählich sickerte das Schlimme durch, das Deutsche anderen angetan hatten. Dagegen drang nur Positives herüber zu uns von Amerika, als der Wiege der Demokratie, als reiches Land, das sich erlauben konnte, Weizenladungen ins Meer zu kippen, nur um Preise stabil zu halten. In der Zeit mühseligen Ährensammelns für eine Handvoll Weizenkörner, die in der Kaffeemühle gemahlen wurden, um eine Magermilchsuppe für die Kinder zu kochen, keimte leicht in vielen jungen Menschen der Wunsch auf, dieses reiche und edle Land kennen zu lernen, wo jeder frei war. Darum ist es nicht verwunderlich, dass nach dem Zweiten Weltkrieg eine neue große Welle der Auswanderung nach Amerika einsetzte.
Der so genannte »Amerikanische Traum« kam mit der schwungvollen Glenn Miller-Musik zu uns herüber und geisterte vielen Jugendlichen in den Fünfzigerjahren im Kopf. Auch ich wollte Amerika sehen. Mit dem leicht erhältlichen Besuchervisum wäre das für wenige Wochen möglich gewesen. Das war zu teuer. Ich musste dort schon arbeiten, und das ging nur mit einem Auswanderungsvisum, das ich 1957 beantragte. Nach der Handelsschule hatte ich als Angestellte gearbeitet und mich über das gelernte Handelsenglisch hinaus in Fernkursen mit der englischen Sprache weiter vertraut gemacht. Ich wollte auf keinen Fall in den Mittleren Westen, wie damals Onkel Jakob und seine Schwester Margarethe. Für mich kam nur eine einzige Stadt in Frage, »the big apple«, New York City. Dort suchte ich mir Arbeit für ein Jahr. Das schien mir auszureichen, den »American dream« in der Realität zu erproben. Die Quote für deutsche Auswanderer war nicht sonderlich hoch, auf diese Liste zu gelangen schwierig. Viele Bescheinigungen waren nötig. Zeugnisse vom Pfarramt, von der Polizei, von Personen der Öffentlichkeit. Seitenweise mussten Fragen beantwortet werden, besonders im Hinblick auf Kontakte zur DDR, zur KPD oder gar zu Personen, die solche Kontakte hatten. Das konnte ich verneinen. Ich musste die Verpflichtung unterschreiben, keinem Amerikaner die Arbeitsstelle wegzunehmen und erinnere mich noch mit einigem Entsetzen gelesen zu haben, dass Einwanderer sich nicht im ältesten Gewerbe der Welt betätigen dürften. Was die schon von den Menschen hielten, die zu ihnen kamen! Ich wurde ärztlich untersucht, meine Lunge wurde geröntgt, meine Fingerabdrücke abgenommen.
Mein New Yorker Arbeitgeber bestätigte seinerseits, dass die für mich vorgesehene Arbeit 12 Monate dauern würde, nicht von Amerikanern erledigt werden könnte, er unterschrieb auch die erforderliche Bürgschaft für dieses Jahr, dass im Falle von Krankheit usw. er für alle Kosten aufkommen würde. Dem Staat durfte ich auf keinen Fall zur Last fallen. Amerika sichert sich bei Einwanderern nach allen Seiten ab. Ich hatte Glück. Mein Name wurde ein Jahr nach Antrag

in die Quotenliste aufgenommen. Dann kam das Einwanderungsvisum, die Schiffskarte, alle benötigten Papiere mit Abreisedatum nach New York, wo ich - noch - keine Menschenseele kannte. Meiner Familie sagte ich erst zwei Tage vor Abreise Bescheid. Wie man in jungen Jahren denkt und handelt! Ich wollte nicht, dass irgend jemand meine Pläne durchkreuzte, wollte alles selbständig, ohne irgendeine Hilfe machen. Ich bat meine Familie, sie möge nicht mit zum Bahnhof gehen. In zwölf Monaten wäre ich ja wieder zurück. Dann ging's aber doch nicht ohne Hilfe meiner Familie! Meine gesamte Barschaft war für Vorbereitungen und jetzt noch die Fahrkarte nach Bremerhaven ausgegeben. Mein Monatsverdienst lag knapp über 200 DM. Mein Bruder Karl Peter sagte auf meine Frage nach einem Darlehen: »Ich hab hier noch 35 Mark, reicht das?« - »Klar!« Das musste reichen. Es waren genau 35 Mark mehr, als mein Gerolsteiner Schulkamerad bei seiner Auswanderung nach Amerika dabei hatte, wie er uns bei einem Klassentreffen berichtete. Doch zunächst ging's in aller Frühe zum ersten Zug Richtung Köln. Allein. Die quer über gespannten Lampen schwankten an den Drahtseilen und erhellten die vom Regen glänzende Hauptstraße. Auf dem Gerolsteiner Bahnhof, zwischen meinen Koffern stehend, mit Blick zur Munterley hinauf, sprangen mir ein paar unerwünschte Ge- danken in den Kopf, die ich rasch verscheuchte. Onkel Peter, der Bruder meines Vaters, hatte mir eindringlich gesagt: »Wir brauchen jetzt doch alle jungen Menschen zum Wiederaufbau in Deutschland, und Tante Margarethe, denk dran, ist früh in Chicago gestorben!« Plötzlich hörte ich eiliges Getrippel von Schuhen. Es ist doch noch ausreichend Zeit bis zur Abfahrt des Kölner Zuges, dachte ich, warum läuft die Frau denn so schnell? Jetzt kam sie die Unterführung hoch. Meine Tante Maria, die Schwester meines Vaters! Einen großen Blumenstrauß im Arm. Den drückte sie mir in die Hand. Sie sah mich nur an, sagte nichts, ihre Tränen sagten genug. Dann war sie weg. Kaum erholt von diesem Ereignis brauste aus Richtung Pelm eine Dampflok herbei, hielt an. Der Lokführer beugte sich zu mir herunter, mein Onkel Pitter aus Büscheich, Bruder meiner Mutter: »Denk dran, egal was ist, wenn du jemand brauchst, du hast Onkel Pitter in Deutschland!« Dann war er mit seiner Lok in einer Rauchwolke verschwunden. Es dauerte bis Euskirchen, meine Gefühle zu beruhigen. Als ich in Köln umstieg, war mir bewusst, das ist die Verbindung zum Wurzelgeflecht meiner Familie, von dem ich mich so leicht herauslösen wollte. Ja, ich gab's zu, dass ich es selbst schmerzhaft spürte, das ist meine Familie, von der ich fortging! Wie ist es jetzt wohl Eltern und Geschwistern am Kaffeetisch zumute? Doch es nutzte nichts, der Zug fuhr mich unweigerlich immer weiter von ihnen und meiner Eifelheimat fort.
Gegenüber den kleinen Seglern von früher, die wochenlang in ihren Bäuchen die Auswanderer aufs Primitivste beherbergten und sie oft genug krank an der amerikanischen Küste entluden, erwartete mich in Bremerhaven ein wahres Juwel der American Lines, ihr Flagship, die »SS United States«, 17 Stockwerke hoch, fasste sie 1972 Passagiere und 1044 Mann Besatzung. Sie war angetrieben durch ölgefeuerte Dampfturbinen, das erste Schiff der Welt, das alle Räume mit Klimaanlagen ausgerüstet hatte. Es gab 19 Aufzüge, zwei Theater, ein beheiztes Meerwasserschwimmbad, fünf große offene Promenadendecks, drei riesige Speiseräume, wo 9000 Mahlzeiten pro Tag serviert wurden. Dafür waren in den Vorratskammern 123.000 Pfund Fleisch, 24.000 Pfund Fisch, 58.000 Pfund Früchte, 65.000 Pfund Gemüse, sogar 7.000 Flaschen Wein und 16.000 Flaschen Bier und andere Getränke vorrätig. Die »SS United States« wurde für 70 Millionen Dollar gemäß den hohen Standards der US Marine, das erste und letzte Schiff dieser Art, von der Newport News Shipbuilding & Drydock Co. in Newport, Virginia, gebaut. Sie blieb das größte Passagierschiff, das je

Freiheitsstatue in New York begrüßt die Einwanderer
in Amerika gebaut wurde. Klar, dass es mich begeisterte! Die SS United States war eine schwimmende Insel mit allem Komfort. Es gab eine Bibliothek, einen Friseursalon, zwei hervorragende Orchester, einen Kinosaal. Sie war ultramodern eingerichtet, mit freundlichen hilfsbereiten Stewards in den Kabinen, an den großen runden Tischen in den Speisesälen. Sie hatten vornehme Umgangsformen, redeten sogar uns Mädchen wie Frauen an, in jedem Satz mit ,»madame« und machten dazu eine kleine Verbeugung. Jetzt war mir der graue Himmel egal, der strömende Regen, die Kapelle samt ihrem Abschiedslied: »Muss i denn, muss i denn zum Städtele hinaus«. Dafür hatte ich keine Stimmung, erst recht keine Zeit: Ich hatte nicht genug Augen, den Luxus und die Größe dieses prächtigen Ozeanriesen zu sehen und zu bestaunen. Während er sich langsam von seiner Anlegestelle entfernte, war ich dabei, das wunderbare Schiff zu erkunden, und mir schien, dass

sich all die Mühe für das Auswanderungsvisum allein schon für diese Fahrt auf der prächtigen »SS United States« gelohnt hatte. Die Neue Welt reichte mir damit ihre Hand bis Bremerhaven zu einem herzlichen Willkommen. Als ich Tante Maria's Blumen versorgt und meine Kleider ausgepackt hatte, verstaute ich im Oberschrank der Kabine noch meine Koffer aus guter deutscher Presspappe, in grün-pepita, mit dunkelgrünen Kanten aus Echtleder. Vorsichtig entrollte ich einem Handtuch die einzige Kostbarkeit, die ich von daheim mitgenommen hatte und legte sie auf meinen Schreibtisch, es war der Lyrikband »Der ewige Brunnen«. Beim Anlegen in New York erfuhr ich, dass ich den Tisch- und Zimmerstewards Trinkgeld zu geben hätte. Jeder erwartete mindestens 30 Dollar. Die Stewards waren ganz sicher enttäuscht, als sie in den Umschlägen, auf die ich »thank you very much« geschrieben hatte, nur je 15 Deutsche Mark fanden. Sie konnten nicht ahnen, dass sie Empfänger fast meines gesamten Darlehns waren. Mit fünf DM, einer großen Portion Optimismus und noch mehr Spannung betrat ich den Boden Amerikas. Die ersten Wochen brachten mir erstaunliche und ernüchternde Erkenntnisse. Dazu zählte die immense Kaufkraft des Dollars, die dort noch gebräuchliche schwarz-weiße Brille, mit der ihr Land und der Rest der Welt gesehen wird, und dass der »American dream« ein Traum bleibt für die meisten Amerikaner. Mit Befremden begegnete mir ihr ungewohnt hohes Maß an Patriotismus. »Love it (America) or leave it!«, sagen sie, wie die meist negative Vorstellung von Deutschland. Und dennoch: Aus zwölf Monaten wurden zwölf Jahre New York. Denn ein halbes Jahr nach Ankunft lernte ich meinen späteren Mann kennen. Unsere Tochter Ingrid wurde in New York geboren. Wir genossen neben der Familie einen schönen Freundeskreis. Mein Mann zeigte mir und unserer Tochter die großartige Natur des Staates New York, den mächtigen Hudson Strom, die vielen Seen, die Bear Mountains, die Catskills sommers wie winters, besonders aber im prächtigen Herbstschmuck. Ich wurde in der Kommune aktiv, das alles ließ mich das Land gern haben. 1970 kehrte ich in meine Heimat zurück, mit Mann und Tochter. Als wir am 2. Mai aus Richtung Hillesheim kommend an den prächtig blühenden Eifelwiesen entlang fuhren, gar mit Wiesenschaumkraut bestanden, das ich so lange nicht mehr gesehen hatte, in der Ferne die hügelige bewaldete Landschaft, hinter der sich meine Heimatstadt verbarg, wo meine Mutter und meine Geschwister auf uns warteten, überkam mich eine nie gekannte panikartige Angst, irgendein Unheil aus heiterem Himmel könnte jetzt noch verhindern, sie und meinen Heimatort wiederzusehen. Nichts passierte. Der Maihimmel blieb freundlich und darunter sahen wir bald, von Munterley und Auberg angekündigt, Gerolstein vor uns. Wir fuhren durch die mir bekannten Straßen. Aus dem heruntergekurbelten Seitenfenster atmete ich Heimatluft, winkte Bekannten und Nachbarn zu. Meine Mutter und die anderen erwarteten uns im Elternhaus. Die Wiedersehensfreude war riesengroß. Mutter atmete glücklich auf: »Jetzt ist unser Wandervogel, der nur zwölf Monate fortbleiben wollte, endlich heimgekehrt!«