reparieren. Die Arbeiten dauerten in den Jahren 1946 und
1947 an,
um den Wiederaufbau voran zu treiben. Der erste Amtsbeigeordnete
Michel Reineke stellt 1948 fest, »dass eine weitere Heranziehung der
Bürger zu unentgeltlichen Leistungen im Interesse der Enttrümmerung und
Beseitigung von Kriegsschäden nicht mehr durchführbar ist«.
1948 waren noch 48 zerstörte Wohn- und 12 Wirtschaftsgebäude nicht wieder aufgebaut, 59 Wohngebäude und
8
Wirtschaftsgebäude noch stark beschädigt. Die Kosten für die
Schadensbeseitigung wurden auf rund 2.100.000 DM beziffert. Drei Jahre
nach Ende des Krieges waren noch 500 Meter Stadtstraßen, 300 Meter
Wasserleitung zu bauen und 4000 Kubikmeter Trümmer abzufahren. Als mit
der Währungsreform am 20. Juni
1948
der wirtschaftliche Aufschwung begann und die Reichsmark abgelöst
wurde, hatte die Gemeinde Daun an Bar- und Buchbeständen 204.000
Reichsmark. Als Ausgleich erhielt sie 12.746 DM der neuen Währung.
Situation in den Orten
Kaum
ein Ort im ehemaligen Amt Daun war nicht von Kriegsfolgen betroffen und
von Bombenabwürfen verschont geblieben, ob gezielt oder durch
Notabwürfe. In den Jahren 1942-45 gingen auf Mehren 82 Bomben nieder;
drei Personen der Familie Karl Häb fanden beim Angriff am 6.2.1945 den
Tod. Die Gebäude Karl Häb, Adam Michels, Elise Brost und Ww. Johann
Thull waren total zerstört, die Anwesen Oellig und Bollinger schwer
beschädigt. Tote waren aber auch durch
Luftangriffe
in Schönbach, Steinborn, Utzerath und Waldkönigen zu beklagen. Zehn
Häuser und landwirtschaftliche Gebäude in Neunkirchen waren durch die
Bombenabwürfe zerstört oder stark beschädigt worden. Die Schäden wurden
in Mehren mit 45.500 DM und mit 102.000 DM in Neunkirchen angegeben.
Beim Bombenangriff auf Kradenb ach (7-8 Sprengbomben)
und anschließendem Bordwaffenbe-schuss am 29.12.1944 brannten die
Gebäude Josef Saxler und Ww. Peter Diewald samt Erntevorräten und
Geräten ab. Die Gebäude Peter Kiewer, Stefan Schüller und Ww. Hubert
Maas wurden schwer beschädigt. Kein einziges Haus war unversehrt -
aber es blieb bei leichteren Verletzungen der Bewohner. Vor allem die
Bahnstrecken
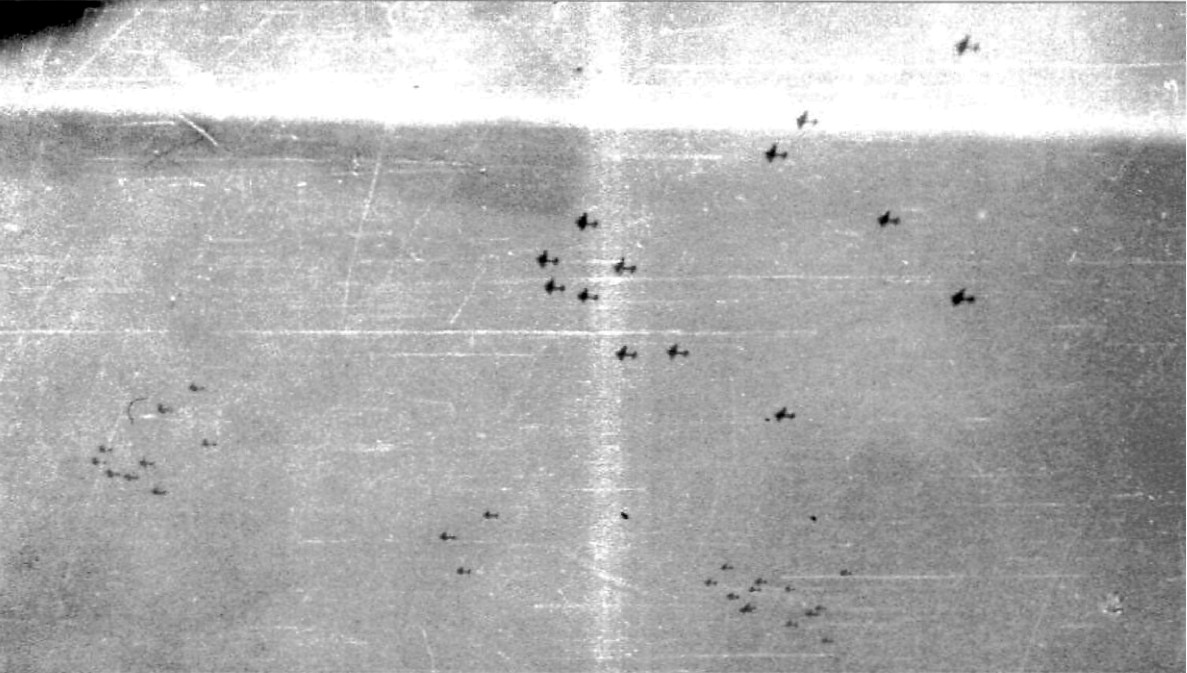
Bomberverband über Daun
