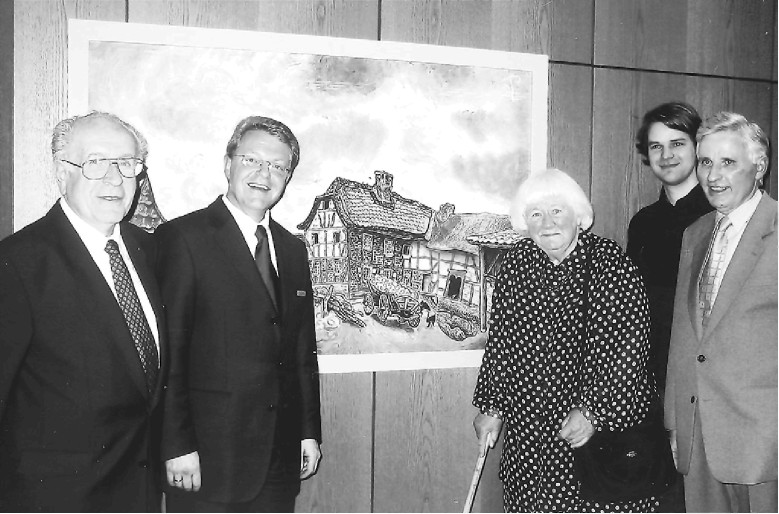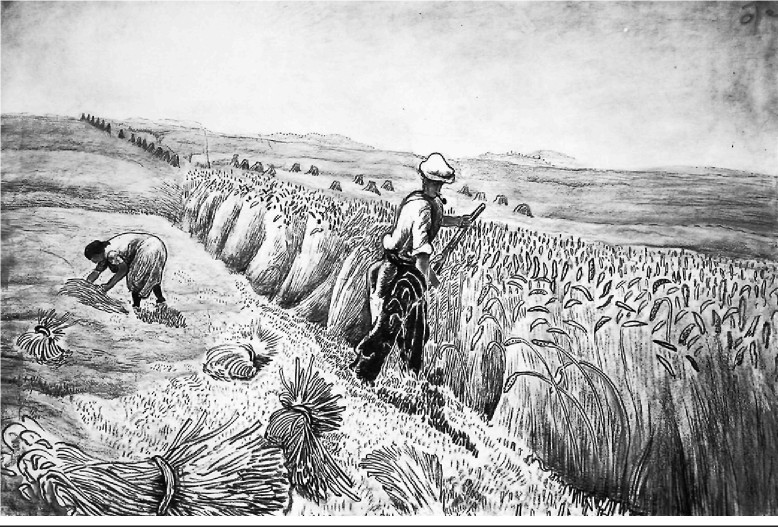|
|
|
|
|
|
|
|
Otto Pankoks Eifelbilder in Daun
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Man
darf es getrost einen Glücksfall nennen, dass der frühere Leiter der
ehemaligen Abteilung Schulen und Kultur bei der Kreisverwaltung Daun
einen Mann kennen lernte, der uns nach Jahren noch außergewöhnlich
nützlich sein würde: Karlheinz Pieroth, über drei Jahrzehnte
Chefredakteur der Kirchenzeitung für das Bistum Aachen und
langjähriger Geschäftsführer der Otto Pankok-Gesellschaft, „ein
kulturell hochinteressierter Mann", wie eine Aachener Zeitung
anlässlich seiner Verabschiedung in den Ruhestand über ihn schrieb. Es
war 1988, als Rektor Gilbert Dup-pich und die Dauner Kreisverwaltung
zum 100. Geburtstag von Alfred Holler eine Kunstausstellung
initiierten und sie, zusammen mit der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Belgiens, der Stadt Eupen, der Wittlicher Galerie Knops sowie der
Kreissparkasse Daun, in Daun und Eupen präsentierten. Damals begann
auch die freundschaftliche Verbindung zu Herrn Pieroth. Sie führte
schließlich dazu, dass es nun glückte, 33 großformatige, künstlerisch
hochwertige Kohlegemälde von Otto Pankok nach Daun zu holen. Sämtliche
Exponate waren Leihgaben des Otto Pankok-Museums in Hünxe-Dreve-
|
nack/Niederrhein.
Frau Eva Pankok, die Tochter des Künstlers, hat sie freundlicherweise
zur Verfügung gestellt, und ihre tüchtige Mitarbeiterin, Frau Waltraud
Meyering, hat sie für diesen Zweck fachgerecht aufgearbeitet.
Einer der bedeutendsten Malern des 20. Jahrhunderts
Otto
Pankok wurde am 6. Juni 1893 als Sohn eines Landarztes in Saarn bei
Mülheim/ Ruhr geboren. Nach dem Abitur besuchte er die Kunstakademien
Düsseldorf und Weimar. Von 1914 bis 1917 war er Soldat, schwer
verwundet kehrte er aus dem Ersten Weltkrieg heim. 1920 ging er nach
Düsseldorf, wurde Mitglied der Künstlergruppe „Junges Rheinland" mit
namhaften Malerkollegen wie Gert Wollheim und Otto Dix im Kreis um
Johanna (Mutter) Ey, der Frau, die zahlreichen jungen Künstlern
Ausstellungsmöglichkeiten in ihrem Kaffeeausschank bot, der sich nach
und nach zu einer Galerie entwickelte. 1921 heiratete er die
Journalistin Hulda Droste. In den Jahren 1924 bis 1931 reiste er nach
Italien, Frankreich, Holland und Spanien. 1925 wurde seine Tochter
Eva geboren. Bei dem Maler, Grafiker und Bildhauer Otto Pankok haben
|
wir
es mit einem Großen der Kunstszene zu tun. Er zählt zu den
bedeutendsten Malern des 20. Jahrhunderts. Sein reiches Lebenswerk
weist ihn als führenden Künstler des Expressiven Realismus in
Deutschland aus. Er war derart genial, dass ihm das Prädikat
„Deutscher van Gogh" zugeschrieben wurde. Tatsächlich war der
holländische Maler sein größtes Vorbild, aber im Unterschied zu ihm,
dem Farbe zum eigentlichen Baustein des Bildes wurde, beschränkte
sich Pankok ausschließlich auf Schwarz-Weiß. Dies ist eine
Besonderheit seiner Kunst, und deswegen ist sie einzigartig. Pankok
gehört gleich Käthe Kollwitz und Ernst Barlach zu den sogenannten
schwarzen Magiern.
Die
Kunst Otto Pankoks ist eine aus dem Herzen kommende Antwort auf die
Schöpfung: Mensch, Tier und Landschaft stehen im Mittelpunkt. Seine
Liebe galt den Verachteten, Unterdrückten und Verfolgten. Von 1931 bis
1934 malte er die Zigeuner im „Heinefeld", einer Armensiedlung am
Stadtrand von Düsseldorf, von Ende der 1930er Jahre bis 1945 „Jüdische
Schicksale". 1933 und 1934 entstand sein bekanntester Zyklus „Die
Passion", die Leidensgeschichte Christi in 60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
großformatigen
Kohlebildern, 1936 gefolgt von einem gleichnamigen Kunstbildband,
allesamt Bekenntnisse zu den Leidenden und zugleich Anklage gegen die
Schergen der Gewalt. Seine in der Zeit der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft geschaffenen Arbeiten sind das nach Umfang und Rang
bedeutendste Zeugnis des Widerstandes der Bildkunst in Deutschland.
Alle diese Werke gingen in große Metropolen in Ost und West, zum
Beispiel nach Moskau, Krakau, Verona und Turin. Im Jahr 2003 wird „Die
Passion" u.a. in Polen, im größten Museum Warschaus, zu sehen sein.
1990 wurde ein Großteil, begleitet von einem stattlichen Katalog, im
Bonner Bundeskanzleramt ausgestellt. Damit sollte, so schrieb der
Hausherr, Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, in seinem Geleitwort, der „vor
fast einem Vierteljahrhundert verstorbene rheinische Künstler geehrt
werden, dessen Werk uns stete Mahnung bleibe." „Für Otto Pankok besteht
ein untrennbarer Zusammenhang zwischen dem Schicksal und dem Leiden
seiner Zeitgenossen, vor allem der Juden und Zigeuner, und der
biblischen Leidensgeschichte", sagte der Bundeskanzler in seiner
Ansprache bei der Ausstellungseröffnung. Pankok habe Unrecht beim
Namen genannt, so Dr. Kohl weiter. Geradezu erschütternd ist die
Tatsache, dass die Malerei Pankoks - dem Himmel sei's geklagt - bis zum
heutigen Tag erschreckend aktuell geblieben ist.
|
Mit
der Machtergreifung der Nationalsozialisten begann für Otto Pankok und
seine Familie eine Leidenszeit. Den Nazis war Pankok ein Dorn im Auge.
Kaum dass sie an der Macht waren, verfolgten sie ihn wie auch viele
andere, die ihm nahe standen, beispielsweise Ernst Barlach, Käthe
Kollwitz und Otto Dix. Seine Bilder wurden aus den Museen verbannt,
seine Kunst auf der Münchener Ausstellung 1937 als „entartet"
verfemt, er selbst wurde mit Mal-und Ausstellungsverbot belegt.
Solche Schikanen konnten ihn jedoch nicht daran hindern, seinen
geraden und mutigen Weg fortzusetzen. Wegen der ständigen Bedrohung
durch die Nazis und der Zerstörung ihres Hauses in Düsseldorf zog die
Familie Pankok in die Eifel, nach Iversheim (1941) und Pesch (1942).
Dort malte der Künstler trotz Arbeitsverbots weiter, u.a. Eifelbilder:
Men-
|
schen,
Tiere und Landschaften. Zum Glück hatte Pankok bereits 1939 begonnen,
seine Bilder zu verstecken. Während seines Aufenthaltes in Pesch
verbarg er sie im Innern der Bühne eines alten Tanzsaales. Hier in
Pesch, dem letzten Zufluchtsort vor dem Kriegsende, tat die Familie
etwas menschlich Großartiges: In ihrer Dachkammer versteckte sie
monatelang den Maler Mathias Barz und seine jüdische Frau, eine
Düsseldorfer Schauspielerin, die dadurch vor dem KZ bewahrt wurde. Im
selben Haus waren zur gleichen Zeit deutsche Wehrmachtssoldaten
einquartiert (!).
Die
Pankoks haben die bittere Zeit der Naziherrschaft überlebt, worüber man
sich eigentlich wundern muss, ebenso darüber, dass fast das gesamte
Werk erhalten geblieben ist. Nach der Befreiung durch die Alliierten
zogen sie heim nach Düsseldorf
|
|
|
|
|
|
|
|
Von links nach rechts: Karlheinz Pieroth, Elmar Schmitz, Eva Pankok, Daniel Ferber, Franz Josef Ferber.
Foto: Brigitte Bettscheider, Kelberg
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1946).
Hier an der Kunstakademie bekam Otto Pankok von 1947 bis 1958 eine
Professur. Danach erwarb die Familie das Haus Esselt bei
Hünxe-Drevenack, Kreis Wesel, wohin sie übersiedelte. Dort befindet
sich heute das Otto Pankok-Museum, das von Eva Pankok und ihren
Freunden betreut wird. Am 20. Oktober 1966 ist Otto Pankok in Wesel
gestorben. Er hat eine riesige Fülle Kunstwerke hinterlassen. Sie
bestehen aus mehr als 6000 Kohlegemälden, fast 800 Holzschnitten,
über 800 Radierungen, 500 Lithos, Steinschnitten, Monotypien und mehr
als 200 plastischen Arbeiten.
Präsentation von Eifelbildern
Wiederholt
hat die Dauner Volksbank in ihren Geschäftsräumen Ausstellungen, zum
Teil auch bekannter Maler wie zum Beispiel Fritz von Wille,
präsentiert. Sie alle fanden die Aufmerksamkeit vieler Kunstfreunde.
Jedoch Kunst-
|
werke
eines so großen Könners wie Otto Pankok in der „Provinz" vorzeigen zu
können, das kommt weiß Gott nicht alle Tage vor. Von den zahlreichen
Eifelbildern, die in Iversheim und Pesch entstanden sind, wurde zur
Erinnerung an Pankoks Jahre in der Eifel eine bescheidene Auswahl
ausgestellt, die meisten Bilder zum erstenmal; fast alle sind trotz
Malverbots in der Kriegszeit entstanden. Nach sorgfältigen
Vorbereitungsarbeiten war es am 8. November 2002 soweit. Eine
stattliche Anzahl Gäste von nah und (mehr noch) von fern war zur
Ausstellungseröffnung ins Volksbankgebäude gekommen, unter ihnen auch
die Tochter des Künstlers; Günter Grass, einer der prominentesten
Schüler Pankoks, hatte sich wegen einer Auslandsreise entschuldigen
lassen. Elmar Schmitz, Vorstandsmitglied der Volksbank RheinAhrEifel
eG, ein begeisterter Förderer dieses großar-
|
tigen
Projektes, begrüßte sie. Dem bereits eingangs erwähnten Herrn Pieroth
war es vorbehalten, sehr gekonnt den Künstler vorzustellen und in sein
Werk einzuführen. Auch interessante, weniger bekannte Einzelheiten
kamen dabei zur Sprache, zum Beispiel, dass Otto Pankok, der seinen
verdienten Dauerplatz unter den größten Künstlern des vergangenen
Jahrhunderts gefunden habe, bei den Passionsbildern den biblischen
Gestalten Züge von ihm persönlich bekannten Menschen gab, wie etwa der
weinenden Maria die der kleinen Zigeunerin Ringela, die später in
einem KZ ermordet wurde. Oder, um weitere Beispiele zu nennen,
Christus am Kreuz bekam das schmerzverzerrte Antlitz eines von
SS-Schergen gefolterten Freundes, des Malers Karl Schwe-sig. Der
fettleibige Hohe Priester gleicht Hermann Göring, während der von
einer fanati-sierten Menschenmenge umgebene Pontius Pilatus an Joseph
Goebbels erinnert, und bei den Folterszenen drängt sich unwillkürlich
die Parallele zu den SA-Schlägerkellern auf. Das musste böses Blut
geben. Der unerschrockene Maler, so Pieroth, habe es tatsächlich
gewagt, einen Teil dieser Bilder in zwei Ausstellungen zu geben, aus
denen sie allerdings sofort entfernt worden seien. Ähnliches sei mit
den Passionsbildern geschehen, die später als Bildband erschienen
sind, sie alle wurden beschlagnahmt. Schließlich erinnerte der Redner
daran, dass die Deutsche
|
|
|
|
|
|
|
|
Mäher (1945 entstanden, Maße: 150 x 99 cm)
Foto: Daniel Ferber, Daun
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bundespost
1993 zum 100. Geburtstag des Künstlers eine Sondermarke mit einem
seiner Holzschnitte „Meer und Sonne" herausgegeben hat, die in einer
Auflage von 25 Millionen Exemplaren um die
|
Welt
gegangen ist. Um die Ausstellung zu dokumentieren, hat die Volksbank
eine ansprechende Broschüre herausgegeben. Sie enthält unter anderem
sämtliche ausgestellten Exponate in Bild
|
und Text. Die Ausstellungsbesucher nahmen das passende Geschenk dankbar an.
|
|
|
|
Literatur:
Material aus dem Archiv des Otto Pankok-Museums Hünxe-Drevenack
|
|
|
|
|
|
|
|