Der große Brand von Gillenfeld
Ein-Blick ins Dorfgeschehen 1876
Gerd Hagedorn, Dahnen
Es war am Nachmittag des 18. August 1876 gegen fünf Uhr, in einem sehr heißen und trockenen Sommer, als ein plötzlich entstandener Brand das Unterdorf von Gillenfeld in Schutt und Asche legte. Das Feuer griff so schnell um sich, dass in kürzester Zeit 72 Häuser mit Scheunen und Stallungen, ein Teil der Tiere, die Ernte und erhebliches Hab und Gut ein Raub der Flammen wurden. Auch zwei Frauen mussten dabei ihr Leben lassen. Über den Brand als solchen, die Ohnmacht der Betroffenen, das Fehlen einer örtlichen Feuerwehr und die Folgen der Katastrophe1 hinaus lässt sich dank glücklicher Umstände Einblick nehmen ins Dorfgeschehen und ein Blick tun auf einige Ereignisse, die mit dem Brand zusammenhängen. Die glücklichen Umstände bestehen einerseits in dem ausführlichen Artikel eines Gil-lenfelders und Augenzeugen in der Trierischen Landeszeitung zum fünfzigsten Jahrestag des verheerenden Feuers2 und andererseits in dem späteren handschriftlichen Bericht des damals sechsjährigen Gillenfelders Anton Hoff3, der alles wachen Sinnes miterlebte und sich, wie er 1939 bei der Niederschrift seiner Memoiren ausdrücklich versicherte, des Brandes noch sehr gut erinnern konnte. Die Vermutung liegt nahe, dass der damals bereits zum Bürgermeister von Dremmen4 avancierte Anton Hoff auch der Urheber des Zeitungsartikels von 1926 sein könnte. Jedenfalls macht er sich den Artikel vollinhaltlich zu eigen, integriert ihn in seine Memoiren und zitiert ihn fast wörtlich in seinem Augenzeugenbericht über den Brand von 1876. Einige Einzelheiten des Geschehens beim großen Brand von Gillenfeld, wie sie glaubwürdiger nicht berichtet werden können, gewähren uns beispielhaft Einblick in das Verhalten der damaligen Dorfgemeinschaft und in die Einstellung seiner Bewohner, die sich seinerzeit wohl kaum von der anderer Dörfer in der gleichen Situation unterschieden haben wird.

Augenzeuge Anton Hoff um 1933
Drohende Feuersgefahr
Seit Monaten wartete man vergeblich auf Regen. Die Sonne hatte den Boden und alles, was darauf stand oder gebaut war, total ausgedörrt. Die Wiesen waren kahl geweidet und von der unbarmherzigen Hitze verbrannt. Das Vieh fand kaum noch einen Grashalm zum Fressen. Das Getreide war vor der Zeit gereift und schon eingescheuert, aber der Hafer stand teilweise noch draußen. Wer arbeiten konnte, war an diesem „Schwarzen Freitag" auf dem Feld, um den Hafer zu mähen und zu binden. Der außergewöhnlich heiße und trockene Sommer 1876 hatte die Gillenfelder nicht nur wegen der Ernte nicht gleichgültig gelassen. Man sorgte sich auch wegen der wachsenden Feuersgefahr. Denn die Häuser waren, außer der Schule, der Bürgermeisterei und einem Gasthaus, alle mit Stroh gedeckt, und die meisten von ihnen bestanden aus Fachwerk, also vor allem aus Holz, Lehm und Stroh. Wegen der großen Dürre hatte die Polizei vorsichtshalber schon angeordnet, dass alle Reiserhaufen aus dem Dorf entfernt werden sollten und dass neben jeder Haustür ein Bottich mit Wasser zu stehen hatte, um im Falle eines Brandes sofort löschen zu können. Zwar gab es im Dorf auch einen Brandweiher und ein Spritzenhaus mit Spritze, aber noch keine Feuerwehr. Eine Brandwache war aber offenbar nicht aufgestellt worden. Alle Vorkehrungen erwiesen sich jedoch als nutzlos, da das mächtige Feuer von Dach zu Dach sprang, nachdem es einmal in der Scheune des Zillgen-Hofes5 ausgebrochen war. In weniger als einer Viertelstunde, wie es heißt, verwandelte es das ganze Unterdorf in ein einziges Flammenmeer. Da waren laienhafte Löschversuche der Einwohner zwecklos, und es dauerte Stunden, bis professionelle Hilfe von auswärts kam. Lediglich die Gebäude waren versichert, und dies auch nur unzureichend. So tat jeder das Nächstliegende: er suchte von seinem beweglichen Hab und Gut zu retten, was zu retten war.
Eine Feuerwehr mit ausgebildeten Kräften war ja noch nicht vorhanden. Von der Situation im Dorf während des Brandes gibt uns der Zeitungsartikel eine Vorstellung: „Unbeschreibliches Getöse erfüllte die Luft. In das Knistern der Flammen, das Krachen der brechenden Balken und stürzenden Mauern mischte sich das Wimmern der Glocken, das Rufen der rettenden Menschen, das Angstgeschrei der in den Ställen eingeschlossenen Tiere, das Brüllen des von der Gluthitze umhergetriebenen Rindviehs, das Jammern der umherirrenden Kinder."
In der Panik, die ein solch riesiges Feuer verursachte, ist die Kopflosigkeit verständlich, die zu manch unsinnigem Tun führte. Da wurden Gardinen abgenommen, Blumentöpfe, Milchkannen und Kochtöpfe gerettet. Männer, die eigentlich das Feuer hätten löschen sollen, hatten im Bierkeller eines Wirtshauses die Fässer angezapft und löschten verzweifelt ihren eigenen Brand. Als sie betrunken waren, fingen sie an zu randalieren. Die Polizei bekam sie nicht mehr in den Griff. Erst als man den stärksten Mann des Dorfes, Johann Hoff, den Vater von Anton Hoff, zu Hilfe holte, konnte dieser die Ordnung wiederherstellen, indem er die Männer aus dem Keller warf und sie auf die Straße setzte, wo sie sich davonmachten.
Rettungsversuche und Hilfe
Trotz aller dunklen Vorahnungen und Befürchtungen wurden die Gillenfelder vom Ausbruch des Feuers total überrascht. Die meisten von ihnen, jedenfalls die im besten Alter, waren draußen auf den Feldern mit der restlichen Ernte beschäftigt. Das Rindvieh war ebenfalls draußen und leckte die ausgedörrten Grasreste der Weiden. Drei Tage vorher waren die Wiesen zur allgemeinen Beweidung freigegeben worden. Am Brandtage hüteten die Schulkinder, vor allem die Jungen, ihre Tiere außerhalb des Dorfes auf der Dürrwiese zwischen Gillenfeld und Saxler. Die Schweine waren auch in Sicherheit. Sie zogen gerade mit der Herde auf Nahrungssuche durch den Wald. Das restliche Vieh in Hof und Stall aber und die verbliebenen Menschen im Dorf waren der Gewalt des Feuers schutzlos ausgeliefert. Der größte Teil der Tiere, die noch im Stall oder auf dem Hof waren, kam um.
Bei der herrschenden Trockenheit und dem aufgekommenen Wind verbreitete sich das Feuer rasend schnell im Unterdorf. Das Oberdorf blieb zwar verschont, fiel aber nur wenige Jahre später, am Ostersonntag 1887, einem Großbrand zum Opfer. Man hatte aber inzwischen dazugelernt, so dass die Schäden nicht gar so verheerend waren wie bei dem Brand im Unterdorf. Vor allem hatte man 1880 eine Freiwillige Feuerwehr gegründet, die 1887 das Allerschlimmste verhindern konnte. Es ist wohl auf die Erlebnisse des erst sechsjährigen Anton Hoff bei diesem schrecklichen Brandunglück zurückzuführen, dass ihm zeit seines Lebens und besonders in seinen öffentlichen Ämtern die Feuerwehr ein besonderes Anliegen war. Dies wurde auch staatlich anerkannt durch das „Erinnerungszeichen für Verdienste um das Feuerlöschwesen", das ihm das Preußische Staatsministerium in Berlin am 22. Oktober 1931 verlieh.
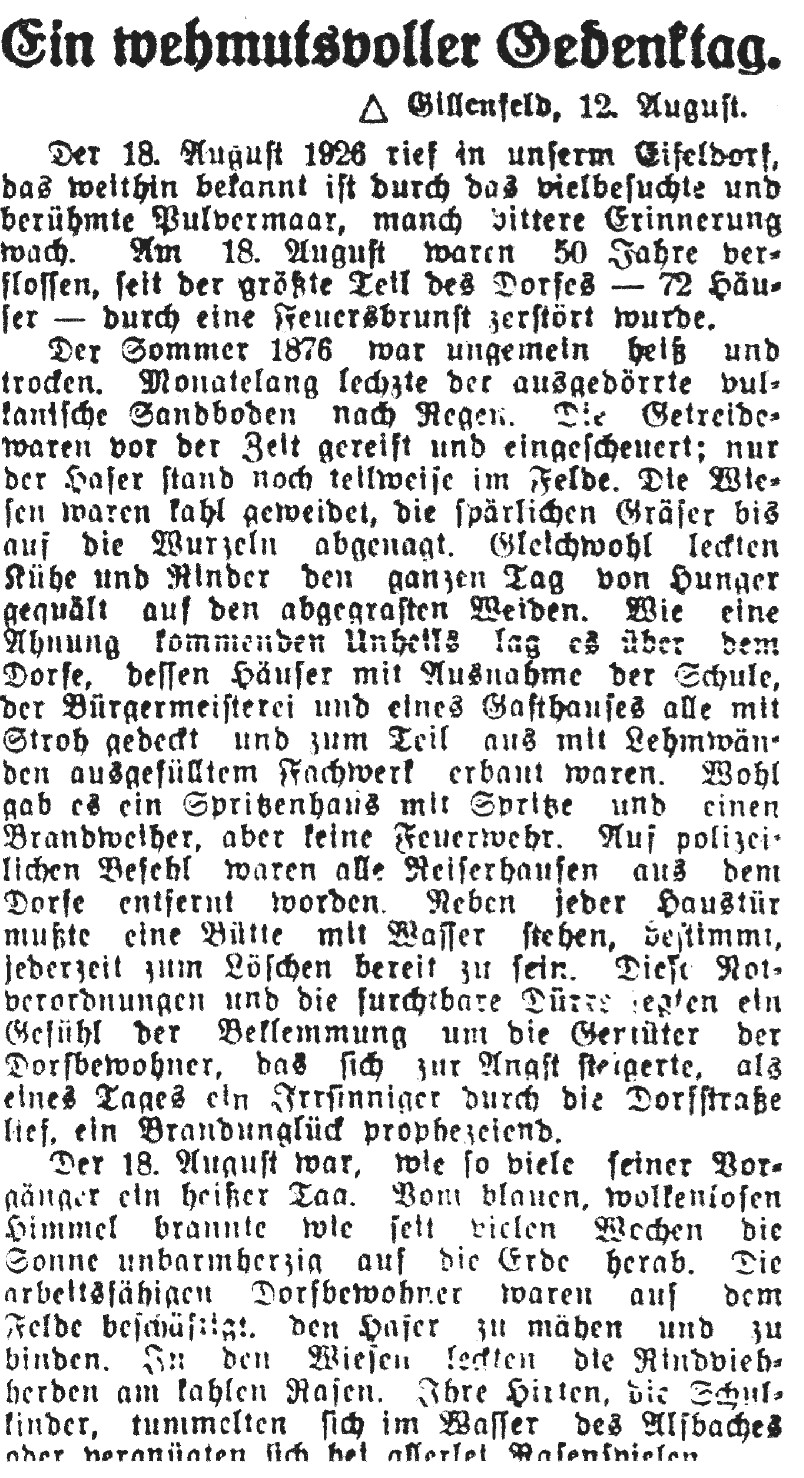
Trierische Landeszeitung vom 19.8.1926
Bei dem sich rasend schnell ausbreitenden Feuer im Unterdorf gab es nicht mehr viel zu retten. Johann Hoff hatte Haus und Hof nur gepachtet. Da die brennenden Häuser und mit ihnen die Ernte sowieso verloren waren, rettete er zuallererst die Pferde aus dem Stall und trieb sie auf die Weide. Da die Stallungen nicht mehr zu erreichen waren, verbrannten die darin befindlichen 20 Schafe, eine Muttersau mit 11 Ferkeln, die Enten und die Hühner mit. Johann Hoff zog dann den Leiterwagen vor die Haustür und warf, so lange es ging, einige Möbel, Bettzeug, Kleidung und Hausrat auf den Wagen. Auch einige Nachbarn benutzten diese Gelegenheit. Dann wurde das Feuer für den hölzernen Wagen zu gefährlich, und Johann Hoff zog ihn über die etwas abschüssige Straße bis auf eine Wiese vor dem Dorf, wo schon viele ähnliche Gefährte standen. Dort fanden am Abend die Familien mit ihren Kindern wieder zusammen. Zwei Frauen wurden vermisst, sie hatten den Brand nicht überlebt.
Die von auswärts herbeigerufenen Feuerwehren trafen, unter den damaligen Verhältnissen, erst nach Stunden, am späteren Abend ein. Mit den damals zur Verfügung stehenden Mitteln wären sie eines solchen Großbrandes wohl auch kaum Herr geworden. Sie löschten, wo noch Balken schwelten, Heu- und Getreidehaufen rauchten oder glimmende Trümmer wieder aufflammten. Um das niedergebrannte Unterdorf herum, auf Feldern und Wiesen, lagerten die Alten, die Kranken und die kleinen Kinder auf den größeren oder kleineren Haufen von gerettetem Hausrat, Bettzeug und Kleidungsstücken und bewachten sie gegen Diebstahl. Die Eltern und größeren Geschwister suchten mit Laternen ihre Kinder, die noch auf den Wiesen die Kühe hüteten. Während das Vieh dort blieb und von Älteren übernommen wurde, bekamen die Kinder und die alten Leute ein Stück Brot von den Einwohnern verschont gebliebener Häuser gebracht und wurden auch dort auf dem Boden zum Schlaf gebettet. Der Schreiber des Zeitungsartikels berichtet, dass er selbst erst gegen Mitternacht mit mehr als zwanzig Kindern und Erwachsenen auf dem Boden einer Stube auf dem rechten Alfbachufer müde und hungrig im Schlafe lag, oft unterbrochen von dem wüsten Getöse, das noch immer vom Dorf herüberkam.
Ein Irrer im Dorf
Wie eine Ahnung kommenden Unheils hatte es schon vorher über dem Dorf gelegen. Die furchtbare Hitze, die Dürre und die einschränkenden Notverordnungen sorgten für ein Gefühl der Beklemmung bei den Einwohnern. Es steigerte sich zu panischer Angst, als wenige Tage vor dem Brand ein Mann von großer, hagerer Gestalt in schwarzem Anzug und Gehrock durch die Dorfstraßen lief und ein großes Unglück prophezeite. Dieser Mann war Pinnen-Öhm, wie er genannt wurde, ein Gillenfelder Bürger aus der Vorstadt, das heißt aus den Häusern auf dem rechten Alfbachufer. Er war schon mehr als sechzig Jahre alt und psychisch krank. „In seinem Wahn ging er im Dorf auf und ab", berichtet Anton Hoff, „wir Kinder hinter ihm her. Er predigte mit lauter Stimme: ,0 Gillenfeld, o Gillenfeld, wie oft habe ich dich gewarnt, aber du hörst nicht auf meine Stimme. Wie wird es dir ergehen? Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Wie eine Henne ihre Küchlein um sich versammelt, so habe ich dich um mich versammelt und dich gewarnt, aber du hast es nicht gewollt'."6 Die Anklänge an die Weissagungen Jesu über Jerusalem und die Endzeit sind unüberhörbar. Anton Hoff fährt fort: „Als dies zu bunt wurde, hat der Bürgermeister Speicher Verhandlungen zur Unterbringung des Kranken in eine Anstalt eingeleitet. Da hierüber einige Tage vergingen und der Mann nicht mehr zu bändigen war - die Angehörigen hatten keinen Einfluß mehr -wurde der Hengsthalter, der anscheinend der kräftigste Mann im Dorfe war, mit der Überwachung beauftragt. Auch diesem versagte der Irrsinnige den Gehorsam. Da wurde bekannt, daß der Einzige, der gefürchtet war, der Müllerhannes war - so hieß mein Vater im Volksmunde. Der Bürgermeister klagte meinem Vater die Angst und das Leid der Einwohner vor dem Jeck und bat ihn, er möge die Aufsicht bis zum Abtransport am nächsten Morgen übernehmen. Mein Vater ging notgedrungen auf den Vorschlag ein, nahm einen Pflugsprenkel, ging den Kranken aufsuchen, wies ihm seine Aufenthaltsstelle unter einem Eichenbaum auf freier Wiese an, mit dem Befehl, diese Stelle nicht zu verlassen. Kaum war mein Vater zu Hause, kamen die Kinder gelaufen und riefen: Pinnen-Öhm kommt das Dorf herauf.' Müllerhannes nahm den Pflugsprenkel und ging dem Ausreißer entgegen, hielt sich etwas versteckt, und als der Irrsinnige seinen Hüter erblickte, machte er kehrt, nahm Reißaus, daß die Rockschöße so flogen, erhielt den Sprenkel7 in die Kniekehlen, dass er zusammenknackste und legte sich dann unter den ihm angewiesenen Baum. Diese Stelle verließ er nicht mehr, bis er am nächsten Morgen abtransportiert worden war in die Heilanstalt zu Merzig. Dort ist er später gestorben."
Hier fällt außer der seinerzeit üblichen rohen Behandlung von Geisteskranken die irrationale Angst der Dorfbewohner vor dem, der anders ist als sie, besonders auf. Von einem solchen befürchtet man Unheil und Böses, er schafft „Angst und Leid", wie man dem Bürgermeister klagt, nicht weil von ihm eine wirkliche Gefahr zu befürchten gewesen wäre, sondern weil er die eigenen Kreise störte, und das ist lästig. Als bequeme Abhilfe schließt man ihn aus der Gemeinschaft aus und macht ihn bei sich bietender Gelegenheit zum Sündenbock. Auch der schon öfter genannte Zeitungsartikel erwähnt düster den unheilschwangeren Irrsinnigen, der „durch die Dorfstraße lief, ein Brandunglück prophezeiend." Gerade dies hatte er allerdings nicht getan, wenn man den überlieferten wörtlichen Text von Anton Hoff zugrunde legt. Es wird ihm hier von der Zeitungsöffentlichkeit einfach etwas unterstellt, weil es so schön passt. In Wirklichkeit hatte der Mann, und dies nicht einmal mit eigenen Worten, die Zerstörung Gil-lenfelds vorausgesagt, ohne die näheren Umstände zu spezifizieren. Die dann folgenden Ereignisse gaben ihm ja sogar Recht. Sein Glück war, dass er rechtzeitig in die Irrenanstalt nach Merzig gebracht worden war, sonst hätte man die Brandkatastrophe sicherlich ihm in die Schuhe geschoben.
Ursache und Folgen des Brandes
Kaum dass der Brand ausgebrochen war, machte man sich natürlich Gedanken darüber, wer der Schuldige war. Eine genaue Ursache hatte niemand feststellen können, also machten Gerüchte die Runde im Dorf. Der psychisch kranke Pinnen-Öhm hatte den Bewohnern von Gillenfeld durch seine Bußpredigten und Prophezeiungen mächtige Angst eingejagt. Deshalb war er natürlich höchst verdächtig, seinen Ankündigungen selbst zur Erfüllung verholfen und das Feuer gelegt zu haben, um Gillenfeld zu zerstören. Diese hochwillkommene Unterstellung scheidet aber aus, da er schon einige Tage vor dem Brand aus dem Dorf weggebracht und in die Heilanstalt in Merzig eingeliefert worden war. So konzentrierte sich das umlaufende Gerücht auf eine „Dienstmagd, die den Aschenkasten mit noch glimmenden Funken auf den Düngerhaufen geleert" und so die schreckliche Katastrophe verursacht haben sollte. Obwohl in Wirklichkeit über die Ursache des Unglücks nichts Konkretes bekannt geworden ist, hebt die Trierische Landeszeitung noch 50 Jahre danach dieses Gerücht durch gesperrten Druck besonders hervor. Man muss wohl vermuten, dass der grässliche Verdacht trotz fehlender Beweise an der armen Magd hängen geblieben ist.
Weitere Personen wurden nicht genannt. Selbst auf die sonst in diesem Zusammenhang schnell verdächtigten, weil unbeliebten jüdischen Viehhändler, die oft ins Dorf kamen, um zu handeln, fiel nicht der Hauch eines Verdachts. Bis heute ist die Brandursache nicht geklärt. Sie kann auf Brandstiftung beruht haben, sie kann aber auch natürliche Ursachen gehabt haben. Für das Ergebnis: die Katastrophe, die Panik, und die betrüblichen Folgen des Brandes ist seine Ursache inzwischen unerheblich geworden.
Eine Folge des Brandes war zunächst die unmittelbare Hilfsbereitschaft. Die vom Brand verschont gebliebenen Dorfbewohner halfen als erste. Sie brachten Nahrungsmittel, stellten zunächst ein Obdach und dann Wohnraum zur Verfügung. Sie halfen wohl auch beim Retten und Löschen. Aber es musste auch offensichtlich der aus den Flammen gerettete Hausrat bewacht und vor Diebstahl geschützt werden. Positiv ist sodann die Welle der Hilfsbereitschaft, die aus dem Rheinland und weit darüber hinaus nach Gillenfeld floss. Sie linderte die erste Not. Bei der großen Zahl derer, die alles verloren hatten, war es aber unmöglich, entsprechenden Ersatz zu leisten. So mussten sich wohl alle hoch verschulden. Eine Reihe von Missernten in den folgenden Jahren ließ Schulden und Zinsen, teils auch wegen des Wuchers, wie der Zeitungsartikel sagt, den Menschen über den Kopf wachsen. Das Endergebnis war, dass anfangs der 1880er-Jahre nicht wenige Gillenfelder Haus und Hof verkauften und die Heimat verließen, um in Amerika ihr Glück zu versuchen.
Wer so gewitzt war wie Johann Hoff, wusste sich zu helfen. Er war ja nicht Eigentümer des abgebrannten Gutshofes, sondern hatte ihn ein Jahr vorher gepachtet. Als etwa vier Wochen nach dem Brand die Hubertusmühle in Gillenfeld wieder frei wurde, pachtete er sie aufs Neue. Da den Leuten das Brotgetreide verbrannt war, mussten sie Mehl und Brot kaufen. Johann Hoff kaufte den Roggen waggonweise in Zülpich ein, mahlte das Korn und verkaufte das Mehl wie auch daraus gebackene Brote, die reißenden Absatz fanden, an die vom Brand Betroffenen.8
Verpasste Gelegenheit
Eine weitere Folge des Brandes wird 1926 von dem Artikel in der Trierischen Landeszeitung unmissverständlich angesprochen. Der weitsichtige, um die touristische Attraktivität seines Dorfes besorgte Gillenfelder Verfasser beklagt noch nach fünfzig Jahren die Tatsache, dass sich nach dem Brand von 1876 keine Behörde um den Wiederaufbau gekümmert habe, dass es keine Bauberatung gab und dass auch keine Bauordnung vorhanden war. So war jeder sich selbst überlassen und baute Haus und Hof natürlich so wieder auf, wie sie vorher gewesen waren. Bedauernd heißt es in dem Artikel: „Wie leicht hätte damals ein Dorfbild entstehen können, das seinesgleichen in Deutschland nicht aufzuweisen hätte. Eine ganze Anzahl der neu aufgebauten Anwesen könnte jetzt einen doppelten Wert haben, ohne dass andere geschädigt worden wären. - Auch beim Aufbau des am Ostersonntag 1887 abgebrannten Teiles des Oberdorfes fehlte es an sachverständiger Beratung; doch hatte dies wegen der weit geringeren Zahl und regelmäßigeren Lage und Form der Bauplätze keine so nachteilige Wirkung, wie sie heute im Unterdorfe in die Erscheinung tritt."
1 Vgl. Hagedorn, Gerd: Der große Brand von 1876 in Gillenfeld und die Folgen, in: Kreis Daun: Jahrbuch 2003, Monschau 2002, 244-246.
2 Vgl. den Artikel: Ein wehmutsvoller Gedenktag, in: Trierische Landeszeitung, 52. Jahrgang, Nr. 190, 19. August 1926: Erste Beilage, S. 2, Rubrik: »Aus Heimatgauen«.
3 Hoff, Anton: Mein Lebensweg (Handschrift auf losen Blättern von 1939, Familienarchiv H. Abschlag).
4 Anton Hoff war von 1920 bis zu seiner Pensionierung 1933 Bürgermeister von Dremmen, heute Ober-bruch-Dremmen (Heinsberg).
5 Später: Gasthof Zur Post.
6 Hoff: Memoiren 13 mit leicht veränderter Zeichensetzung.
7 Ein Sprenkel ist ein handlicher, kräftiger Knüppel aus frischem Eichenholz.
8 Vgl. Hagedorn, Gerd: Der große Brand von 1876 in Gillenfeld und die Folgen, in: Kreis Daun: Jahrbuch 2003, Monschau 2002, 245-246.