Nach Beendigung meines Medizinstudiums in Bonn, 1919, ließ ich mich im Februar 1922 als praktischer Arzt in Daun nieder. Ich mietete in einem kleinen Geschäft (Frau Peter Groß) zwei Räume mit einem Tisch, einem Sessel, zwei Stühlen und einem kleinen Schrank (Sprechzimmer und ein kleines Wartezimmer). Das Instrumentarium war notdürftig. Ein hölzernes Stethoskop, Mikroskop, eine handgetriebene Schleuder, Injektionsspritzen und ein Geburtsbesteck. Zwei Kollegen waren noch im Ort, Herr Dr. Hilgers und der Kreisarzt, der nebenbei praktizierte und etwas operativ tätig war. Er wurde nach einigen Monaten versetzt. Zu Hausbesuchen stand mir ein Fahrrad zur Verfügung.
Mit Sorgen und Beklemmung wartete ich am ersten Tag meiner ärztlichen Tätigkeit auf die Patienten. Mittags erschien ein pfiffiger Bauer aus Mehren. Er bat mich, seine Tochter in Mehren zu besuchen, die an Ischias rechts leide. Ich fand bei der ersten Untersuchung einen großen Abszess, der über den Beckenrand hinausragte. Die Punktion an Ort und Stelle ergab Eiter. Groß war die Überraschung im Krankenhaus, als ich schon am ersten Tag eine Patientin einwies und am nächsten Tag operierte. Die Kranke erholte sich schnell. Nach dieser gelungenen Operation hatte ich sofort starken Zulauf, da sich das gute Ergebnis dieser Operation wie ein Lauffeuer verbreitete. Mit einem geliehenen Fahrrad - ein Fahrrad gab es damals in Daun noch nicht zu kaufen - machte ich Hausbesuche. Es ging bergauf -bergab, auf guten und schlechten Straßen, oft bis zu hundert Kilometer am Tag. Ich musste bis zu 40 Ortschaften betreuen, bei Entfernungen bis zu 22 km bei einem Besuch. Am 25.7.1922 heiratete ich in Aachen. In Daun zogen wir in die Parterrewohnung des Hauses von Frau Sanitätsrat Dr. Schramm, gegenüber dem Krankenhaus, ein. Kümmerlich vegetierten wir infolge der Inflation dahin. Ich brachte Brot, Milch und ab und zu etwas Speck mit von den Überland-Hausbesuchen. Ärztlich war ich ganz auf mich alleine gestellt. Es gab keine fachärztliche Hilfe. Neben der operativen Tätigkeit musste ich Geburtshelfer sein, Trommelfelle durchstechen, Zähne ziehen (einen Zahnarzt gab es noch nicht), Tonsillektomien durchführen etc. Ab und zu half ich auch dem Tierarzt bei Knochenbrüchen eines wertvollen Tieres (gipsen). Auf entfernten Hausbesuchen musste ich häufiger zuerst ein krankes Stück Vieh untersuchen und behandeln, bevor ich zu den erkrankten Familienangehörigen geführt wurde. Der alte Frisör Siebenmorgen, Feldscher im Krieg 1870/71, zog über die Lande. Er hatte die Erlaubnis, Zähne zu ziehen und war Laien-Leichenbeschauer. Dadurch war die statistische Erfassung von Krankheiten eine Unmöglichkeit. Die Krankheitsbezeichnungen "Lungentuberkulose" oder "Krebs" als Todesursache fassten die Leute als persönliche Beleidigung auf. So war es nicht zu verwundern, dass mit Einführung der ärztlichen Leichenschau "Tbc" und "Krebs" als Todesursache rapide in die Höhe schnellten.
In aller Frühe ging ich zum Krankenhaus. Ich operierte die landläufigen Operationen mit Hilfe von zwei Ordensschwestern. Eine war Operationsschwester, die andere machte die Narkose. Im Operationssaal stand ein schöner Küchenherd, der mit Kohle und Holz beheizt wurde, der zum Erwärmen der Räume und zum Sterilisieren der Instrumente mit "Auskochen" bestimmt war. Im Sommer war dadurch die Hitze in den Räumen oft unerträglich. Trotz dieser primitiven Einrichtung ist alles mit der "Sterilität" durchweg gut verlaufen. Als Vertrauensarzt der Berufsgenossenschaft hatte ich viel mit Unfällen (Landwirtschaft) zu tun. Meine tägliche Arbeit bestand aus Blinddarmund Bruchoperationen, Geburtshilfe, Knochenbrüchen, groben Verletzungen, Verrenkungen, Durchstechen von Trommelfellen, kurz alles, was in einer so ausgedehnten Landpraxis vorkam. Nach dem Wegzug von Dr. Hilgers kam der junge Arzt Dr. Kreuz nach Daun. Nun betreuten wir beide die ca. 40 umliegenden Dörfer.
Die Geburtshilfe belastete mich natürlich besonders. Nächtelang musste ich oft in den Häusern warten und warten, weil viel zu früh angerufen wurde. Von entfernten Ortschaften wieder zurück nach Daun zu fahren, war oft wegen der großen Entfernungen und der schlechten Wegeverhältnisse nicht möglich, besonders im Winter bei Schnee und Eis. Selten kam eine Frau zur Entbindung ins Krankenhaus, da die Schwestern sich anfangs noch, vermutlich mehr aus religiösen Gründen, gegen stationäre Entbindungen sträubten. Verschleppte Querlagen mit Wendungen, hohe Zangen bei verengten Becken durch Rachitis, verursachten Schwerstarbeit und machten mir große Sorgen.
Zu einer wohl einmaligen Entbindung kam es in Wallenborn. Von der Hebamme wurde ich gerufen, weil bei einer Wöchnerin eine Hand des Kindes aus der Scheide hing. Ich fuhr mit dem jungen Medizinstudenten Richard Kuhnen aus Vallendar, der die Semesterferien bei Verwandten in Daun verbrachte, sofort nach Wallenborn. Nach vorgeschriebener Waschung fand ich bei der Untersuchung merkwürdigerweise keinerlei Widerstand im Uterus, auch waren nach Auskunft der Hebamme noch keine Wehen aufgetreten. Sie konnte sich das nicht erklären. "Mir schwant, ich bin in der freien Bauchhöhle", erklärte ich ihr. Ich wendete das Kind auf den Fuß und extrahierte es. Die Geburt ging dann glatt von statten. Das Kind war blass und atmete nicht. Etwa eine Stunde mussten wir uns bemühen, bis es endlich kräftig schrie und lebensfähig war. Als ich daraufhin fortgehen wollte, um noch einige Besuche im Ort zu machen, erbrach die Wöchnerin. Sie beruhigte mich, sie habe bei der letzten Geburt auch mehrmals Erbrechen gehabt. Da das Allgemeinbefinden gut war, ließ ich mich überreden und machte meine Hausbesuche. Nach einer Stunde kam ich zurück und erkundigte mich sofort nach der Nachgeburt. Die Hebamme sagte, sie habe so etwas noch nie erlebt. Wie bei der Geburt, sei auch zur Nachgeburt, die noch fehlte, bisher noch keine Wehe aufgetreten. Inzwischen waren fast zwei Stunden vergangen. Bei der Untersuchung fand ich keine Plazenta. Die Nachgeburt musste demnach gelöst in der Scheide liegen. Ich bat die Hebamme, an der Nabelschnur zu ziehen, um die Plazenta heraus zu befördern, woraufhin die Wöchnerin schmerzhaft aufschrie. Ich bemerkte beim erneuten Ziehen an der Nabelschnur, wie die Bauchdecke in Nabelhöhe sich einzog, und die Frau klagte auch an dieser Stelle über Schmerzen. Ich musste versuchen, die Plazenta manuell zu lösen. Nach einer erneuten Rauschnarkose, landete ich bei der Untersuchung in einem kleinen Hohlraum, konnte aber den Uterus nicht ertasten. Ich kletterte an der gestrafften Nabelschnur in die Höhe, erfasste mit den Fingerspitzen die Plazenta und zog sie, bei gleichzeitigem Zug an der Nabelschnur, heraus. Mit der Plazenta kamen Darm und Netz aus der Scheide, die mit der Plazenta fest verbacken waren. Das Kind hatte sich außerhalb der Gebärmutter entwickelt. In Udersdorf musste ich Frau Sch. zum siebenten Mal entbinden. Sie hatte immer schwere Geburten gehabt. Die gute Hebamme machte mich darauf aufmerksam, dass die Frau während der Schwangerschaft keine frische Bettwäsche aufziehen durfte. Die Großmutter führte die schweren Geburten auf die frische Wäsche zurück. Auf dem Leinentuch, auf dem ihre Tochter das Kind empfangen habe, müsse auch die Entbindung stattfinden. Die Tochter befolgte den Rat der Großmutter und hatte neun Monate die Bettwäsche nicht gewechselt! Ich wurde nach Meisburg zu einer total ausgebluteten Frau gerufen. Sie hatte acht Tage vorher erneut entbunden unter Beistand eines Nachbarkollegen aus Manderscheid. Die Ursache der plötzlich starken Blutung war eine Nebenplazenta, die ich manuell entfernen konnte. Die Blutung stand. In Ermangelung einer Bluttransfusion wurde per Einlauf das durch ein Tuch gedrückte Blut über den Darm wieder zugeführt. Wir versuchten damals uns mit solchen primitiven Verfahren zu helfen. Ich sah plötzlich, dass der Kleinfinger der Frau mittels eines Schuhriemen abgebunden war, worauf die Großmutter mir erklärte, das sei bei ihnen so üblich bei einer Blutung, um diese zum Stehen zu bringen. Der Arzt war nur zwanzig Kilometer entfernt zu erreichen, so habe sie dieses Verfahren erst einmal angewendet. Da dies nicht half, köpfte sie einen Hahn, fing das Blut in einer Tasse auf und gab es der ausgebluteten Frau zu trinken. Die Großmutter erklärte mir, dass das Hahnenblut zu einer Verklumpung des Blutes führen würde, wodurch die Blutung nachlasse. Eines Tages erschien ein nicht mehr ganz junger Bauer aus Üdersdorf mit seiner Tochter in meiner Sprechstunde. Ich stellte eine Schwangerschaft fest im sechsten Monat. Spornstreichs verließ er mit seiner Tochter meine Praxis und lief zum Kollegen Dr. H., dem er erklärte, ich hätte bei seiner Tochter eine große Geschwulst im Leib diagnostiziert. Dr. H. bestätigte, nichts ahnend, die Geschwulst. Der Bauer kam schimpfend zurück in meine Praxis. Ich war unterwegs zu Hausbesuchen. So erklärte er meiner Frau, ich hätte mich getäuscht, seine Tochter habe eine große Geschwulst im Bauch und keine Schwangerschaft!
Ich klärte die Hebamme des Ortes über die Situation auf. Sie sagte mir, der ganze Ort wisse Bescheid, der Kindsvater der Tochter sei der eigene Vater.
Es war gerade österliche Zeit, und die Tochter berichtete bei der Beichte dem Ortspastor von der durch ihren Vater verursachten Schwangerschaft. Dieser schickte sie nach Hause mit der Ermahnung, sie müsse sich vorab öffentlich zu der Schwangerschaft und ihrem Verursacher bekennen, dann erst könne er sie lossprechen. Daraufhin verklagte der Vater den Pastor wegen Verleumdung. In seiner Not kam der Pastor zu mir. Ich beruhigte ihn, da kein Zweifel an der Schwangerschaft bestand, und erklärte mich bereit, bei Gericht für ihn einzutreten.
An einem Sonntagmittag kam es zur Geburt. Der Vater hatte seiner Tochter ein Lager, versteckt in der Scheune, eingerichtet, um ihr alleine bei der Geburt zu helfen. Nach der Geburt eines gesunden Jungen trat eine starke Nachblutung ein, die er nicht beherrschen konnte. In seiner Not rannte er zur Hebamme. Als beide zur Tochter kamen, lag sie bereits im Sterben. Das Kind starb zwei bis drei Jahre später an einer Meningitis und der Vater bald darauf an einem Schlaganfall. So endete ein Familiendrama.
Die Inflation ging zu Ende. Für eine Billion bekam man eine neue Mark. Schnell ging es bergauf. Das geliehene Fahrrad konnte ich zurückgeben. 1924 kaufte ich vom Drogisten Hans Hoffmann einen kleinen Citroen Zweisitzer. Herr Hoffman erklärte mir das Kuppeln und Schalten der Gänge innerhalb einer Stunde bei Fahrversuchen auf seinem Hof. Dann wurde der Wagen vor dem Hotel Hommes auf die abschüssige Straße nach Unterdaun geschoben, und ich fuhr im ersten Gang bis nach Üdersdorf. Zurück fuhr ich bereits im zweiten Gang. So hatte ich das Autofahren gelernt.
Als erste Maßnahme wurden alle Beamten der Behörden, bis auf den Kreissekretär Breyer und den Kreisarzt, ausgewiesen. Der passive Widerstand setzte ein. Das ganze Leben stagnierte. Mit dem Regie(Franzosen)zug wurde nicht gefahren, lieber lief man stundenweit zu Fuß. Außer dem Kreissekretär gab es keine Kreisbehörde, kein Bürgermeisteramt, kein Finanzamt mehr. Man versuchte, alle Behörden und einflussreichen Bürger auszuschalten, um freie Hand im Rheinland zu haben. Der Kreiskommandant Deroy, Rechtsanwalt aus Paris, ging mit wahrem Sadismus gegen die Leute vor. Berüchtigt waren einige seiner Gendarmen, Elsässer und ehemalige deutsche Soldaten. Die Frau eines dieser Gendarmen hatte ich bei einer Zwillingsgeburt entbunden, und sie war mir stets dankbar. Sie teilte mir immer wieder mit, wenn jemand verhaftet werden sollte. Spät abends klingelte es. Mit einem schwarzen Cape vermummt, stand sie vor der Türe und erzählte mir rasch, was sie von ihrem Mann erfahren hatte. So konnte ich unseren Nachbarn, Herrn Amtsrichter Hoffsümmer, warnen. Man wollte ihn am nächsten Morgen verhaften und bei Limburg über die Grenze abschieben. Herr Lehrer Löscher aus Ellscheid half mir, alle Wertsachen, Bilder, Teppiche und Wäsche aus dem Haus Hoffsümmer in die Klausur der Schwestern des Krankenhauses zu bringen, wo sie sicher aufgehoben waren. Am nächsten Morgen wurden Herr Hoffsümmer und seine Frau in aller Frühe abtransportiert. Mit dem französischen Stadtkommandanten hatte ich viele Auseinandersetzungen. So war es nicht verwunderlich, dass spät abends die Frau des Gendarmen erschien und mir weinend mitteilte, ich würde am nächsten Morgen, zusammen mit Herrn Bernhard Fries (Hotelier), verhaftet und fortgeschafft. Das Schicksal wollte es aber anders. Meine Frau erkrankte plötzlich an heftigen Leibschmerzen, und ich musste sie noch in der Nacht an einem akuten Blinddarm operieren, obschon sie im siebenten Monat schwanger war. Die Gendarmenfrau hatte ich benachrichtigt und von ihrem Mann verlangt, unverzüglich den Kommandanten von der Lage in Kenntnis zu setzten. So wurde am folgenden Morgen nur Herr Fries abtransportiert und meine Ausweisung hinausgeschoben. "Aufgeschoben ist nicht aufgehoben", soll der Kommandant gesagt haben.
Es sollte aber anders kommen. Ein französischer Gendarm, wohnhaft in Lourdes, wurde nach einer schweren Lungenentzündung aus dem Lazarett in Trier entlassen, erkrankte aber einige Tage später in Daun an einer eitrigen Rippenfellentzündung. Ich verlegte ihn in die operative Abteilung des Krankenhauses und führte eine Rippenresektion durch. Nach schwerem und langem Krankenlager genas der Patient wieder völlig. Ein höherer französischer Sanitätsoffizier aus Trier hatte ihn mehrmals besucht und sich nach dem Krankheitsverlauf erkundigt. Nach der Entlassung des Patienten erschien Herr Kreissekretär Breyer und überreichte mir einen Dankesbrief des Regierungspräsidenten. Nun konnte mir seitens der Franzosen nicht mehr viel passieren.
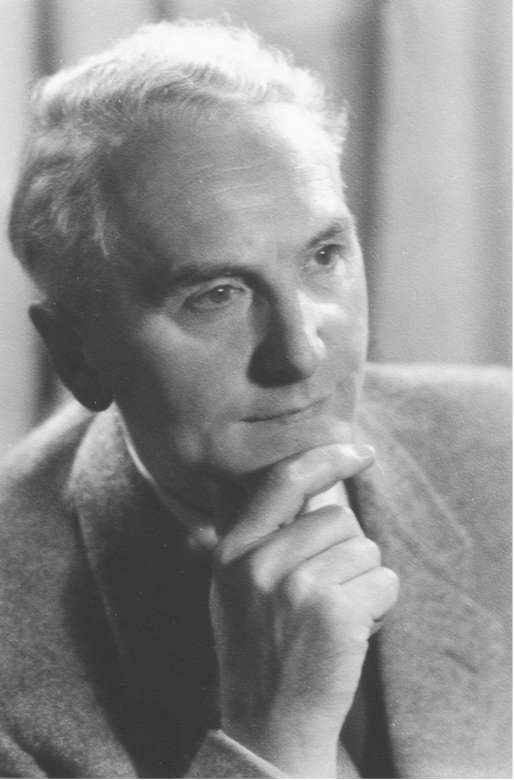
Plötzlich waren sie da, von den Franzosen unterstützt, welche hofften, mit ihrer Hilfe das Rheinland zu annektieren. Wie die Wegelagerer zogen sie durch das Land. Mit Schlägermützen und Militärgewehren beunruhigten sie die Bevölkerung und beschlagnahmten, was sie benötigten. Als sie beim Metzgermeister Daube Fleisch beschlagnahmen wollten, jagte er sie mit erhobenem Beil hinaus und rief: "Ich spalte jedem den Schädel, der versucht hier etwas weg zu holen." Im Landratsamt Daun bezogen sie ihr Hauptquartier. Auf dem Dach wehte die Separatistenfahne. Drei Dauner Jungen kletterten auf das Dach, holten die Fahne herunter, zerstückelten sie in kleine Fetzen und streuten diese vor die französische Kommandantur auf die Straße. Anschließend verdrückten sie sich in die englische Besatzungszone und schickten dem französischen Kommandanten ein Spotttelegramm. Der Widerstand der Bevölkerung gegen den Separatismus nahm zu!
Ein Trupp Separatisten fuhr eines Tages mit einem Lastwagen nach Schleiden und schleppte den damaligen Landrat Graf Spee nach Daun ins Gefängnis. Im Separatistenhauptquartier, Hotel Schramm in Daun, beratschlagte man, was mit dem Gefangenen geschehen sollte. Es wurde beschlossen, ihn ins Gefängnis nach Koblenz zu transportieren. Durch Frl. Änne Schramm, die hinter einer Türe die Gespräche belauscht hatte, erfuhr ich von dem Geschehen. Ich machte mich sofort auf den Weg nach Koblenz. Am dortigen Schloss, dem Hauptquartier der Separatistenregierung, wollten mich französische Doppelposten und Separatisten mit Schlägermützen und umgehängtem Gewehr am Eintritt in das Schloss hindern. Ich verlangte, zum Regierungsmitglied Dr. K., (ein ehemaliger Schulkamerad), in dringender Familienangelegenheit, geführt zu werden Dr. K. war nicht wenig überrascht, mich zu sehen. Ich berichtete ihm von der Verhaftung des Landrates Graf Spee, was er anfangs nicht glauben wollte. Dann ging ich gleich aufs Ganze und verlangte eine Bereinigung der Angelegenheit. Mein Schulkamerad erreichte, dass Graf Spee sofort bei Limburg über die Grenze abgeschoben wurde. Am 26.11. 1923 löste sich die "vorläufige Regierung" wieder auf.
Als eine spontane Reaktion auf den Versuch der Franzosen, das Rheinland vom Reich zu trennen, kam es zu einem passiven Widerstand. Da auch die Eisenbahner streikten, setzten die Franzosen eigene Züge (so genannte Regiezüge) ein, die kaum benutzt wurden. Die streikenden Bahnbeamten und die Bahnarbeiter erhielten keinen Lohn mehr und mussten heimlich aus einer anderen Quelle Lohn beziehen. So begegnete ich auf dem Weg nach Darscheid (von dort fuhr noch ein deutscher Zug bis Plaid) einem Lastwagen, beladen mit Bimssteinen. Der Mitfahrer, Kaspar K., erkannte mich Unter den Bimssteinen hatte er die Löhnung für die Bahnbediensteten des Bezirks Trier versteckt.
Postmeister Kiefer aus Daun erhielt von den Franzosen den Befehl, ein Kabel zu dem unter Regieverwaltung stehenden Dauner Bahnhof verlegen zu lassen. Nach telefonischer Rücksprache mit seiner vorgesetzten Dienststelle in Trier, überließ man die Entscheidung über eine Kabelverlegung ihm selbst. Herr Kiefer weigerte sich, wurde sofort verhaftet und mit unbekanntem Ziel abtransportiert. Als das sabotierende Bahnpersonal der Arbeit fern blieb, alarmierte der berüchtigte Kommandant D. eine Schwadron Spahis (Angehörige einer aus nordafrikanischen Eingeborenen gebildeten französischen Reitertruppe), die von Trier angeritten kamen und mit gefällten Lanzen, zum Gaudium der Bevölkerung, den Bahnhof Daun stürmten, in dem sich kein Mensch aufhielt.
Frau Postmeister Kiefer war völlig zusammengebrochen, da wir trotz aller Rückfragen nach Wochen noch nichts über den Aufenthaltsort ihres Mannes in Erfahrung bringen konnten. Ich machte mich schließlich auf den Weg nach Bonn, da er möglicherweise dort im Zuchthaus einsaß. Zu Fuß ging ich nach Darscheid. Von dort aus fuhr ich mit dem deutschen Zug bis hinter Mayen und ging dann per pedes bis nach Andernach. Dort erreichte ich einen Rheindampfer, der mich bis nach Bonn brachte. Auf der ganzen Reise hatte ich keinen französischen Zug benutzt! In Bonn ging ich zum Gefängnis in der Wilhelmstraße. An der Pforte saß ein deutscher Polizeibeamter, der mit sich reden ließ. Im Gespräch erwähnte ich, dass wir beide Soldat gewesen und somit auch verpflichtet seien, uns gegenseitig zu helfen. Ich fragte nach dem Gefangenen, Herrn Kiefer aus Daun. Er kannte den Namen nicht, da die

Franzosen eine Liste der Gefangenen nicht veröffentlicht hatten. Aus dem Fenster der Pforte konnte ich den Gefängnishof einsehen. Er machte mir den Vorschlag am Fenster stehen zu bleiben, da die Gefangenen in Kürze zu ihren täglichen Rundgang, Mann hinter Mann, in einem Abstand von zwei Metern, aufgerufen würden. Ich konnte Herrn Kiefer nicht erkennen. Darauflief ich auf den Gefängnishof und reihte mich in die Gruppe der Hofgänger ein. Wie ein Lauffeuer wurde meine Frage nach Herrn Kiefer weitergegeben, jedoch vorerst ohne Ergebnis. Aber ein inhaftierter Beamten aus Trier konnte sie beantworten. Er war, zusammen mit Herrn Kiefer, von Trier nach Koblenz und von dort nach Bonn transportiert worden, Herr Kiefer aber nach Mainz. Nun wusste ich endlich, wo der Gesuchte zu finden war. Eilig verließ ich den Gefängnisbau, kam unbemerkt von den französischen Wachposten wieder zur Pforte, bedankte mich kurz bei dem deutschen Polizisten, nahm Hut und Mantel und verschwand. Zu Hause informierte ich das Rote Kreuz in Mainz. Durch dessen Intervention wurde erreicht, dass Herr Kiefer aus der Einzelhaft entlassen wurde, wieder Briefkontakt zu den Angehörigen hatte und Pakete erhalten durfte. Er kehrte als kranker Mann aus der Haft zurück und konnte sich danach nie mehr recht erholen.
Sie war weitaus schlimmer zu ertragen als die Besatzungszeit und der Separatismus, auch weil man sich jetzt mit eigenen Volksgenossen auseinander setzen musste. Im "Stahlhelm" versammelten sich anständige Bürger und alte Soldaten. Ich wurde als Stahlhelmarzt tätig. Ein Bataillon wurde aufgestellt, ausgerüstet mit Gewehren und Maschinengewehren, von vernünftigen Männern angeführt. Es wurde für Ordnung und Disziplin gesorgt. Eines Tages rückten die braunen Gesellen an, der "Stahlhelm" musste weichen und sich auf Regierungsbefehl in die SA eingliedern. Ich hatte mich noch mit Hilfe von Herrn J. rückwirkend aus dem "Stahlhelm" abgemeldet und kam so an einer Mitgliedschaft in der SA vorbei. Ich war schon lange Mitglied in der Zentrumspartei. Ich traf auf einem Spaziergang unseren Schulrat G., der mich dringend darum bat, doch als Arzt dem Zentrum die Treue zu halten. Die Bevölkerung erwartete dies von mir. Tags darauf kam er und erklärte mir mit strahlenden Miene: "Ich bin jetzt Parteigenosse geworden und freue mich, endlich offen bekennen zu dürfen, was ich mir so lange ersehnt habe." Wegen dieser Gesinnungslumperei war er für mich ab sofort "gestorben". Der Schulmeister F. war durch Vermittlung des Pastors Lehrer in Ü. geworden. Mit fliegenden Fahnen trat er in die Nazipartei ein und wurde Kreispropagandaredner. In seinem Eifer zog er mit den Kindern von Parteigenossen johlend durch das Dorf, belästigte anständige Leute und fiel dem Pastor bei der Sonntagspredigt in das Wort etc. Die Nazikinder trennte er in der Schule von den "Verrätern" (Kinder von Vätern, die nicht in die Partei eingetreten waren) und ließ neben den "Böcken und Schafen" eine Bank frei. Eines Tages beorderte er die "Böcke" mit Schöpfkellen und Eimern zu sich. Sie mussten seine Abortgrube entleeren, dabei stieß er Kinder in die Sch...! Ich hetzte vernünftige Bauernjungen auf, und empfahl ihnen, das Schwein mit der Peitsche aus dem Dorf zu treiben. Sie hatten aber zuviel Angst vor der Partei.
Zusammen mit dem guten, alten, pensionierten Lehrer Sch. beriet ich, was zu tun sei. Es wurde ein Schreiben an die Kreisleitung, an den Provinzial-Schulrat in Trier und an das Ministerium in Berlin geschickt, mit Schilderung der obigen Begebenheiten. "Von der Kreisleitung in Daun und Trier ist keine Hilfe zu erwarten. Sollte man uns im Stich lassen, würden die Eifler zur Selbsthilfe schreiten. Wir Eifelbauern haben auch noch Fäuste!" Nach bereits kurzer Zeit kam Nachricht aus Berlin. Der Lehrer musste innerhalb von zwei Stunden den Ort endgültig verlassen. Unglaubliches leistete sich ein Hauptlehrer, der aufgrund seiner hervorragenden nationalsozialistischen Gesinnung, auch als Kreisjugendführer, in die Kreisstadt Daun versetzt worden war. Schon als Lehrer in D. hatte er sich Unfassbares geleistet. Ich musste ein Schulkind mit einer hochfieberhaften Blinddarmentzündung ins Krankenhaus einweisen, es litt außerdem an blutigem, stinkendem Ausfluss. Da ein kriminelles Vergehen an dem Kind nicht auszuschließen war, es lag bereits auf dem Operationstisch, fragte ich es, ob jemand sich an ihr vergangen habe. Ängstlich und verlegen wollte es nicht mit der Sprache heraus. Ich erklärte ihm, es müsse mir ohne Scheu alles erzählen, auch dem Herrn Pastor, den ich als Zeugen bestellt hatte. Anderenfalls könnte ich nicht mit der erforderlichen Sicherheit operieren. Sie gestand mir, ihr Lehrer hätte sie, sonntags nach der Christenlehre, in die Schule bestellt, und sich an ihr vergangen. Fast jeden Sonntag habe er ein anderes Kind bestellt. Sie wisse es von acht Kindern ihrer Klasse. Sollten die Kinder ihn verraten, würde er sie bestrafen und Ostern nicht versetzen. Nach der Operation des kurz vor der Perforation stehenden Blinddarms gesundete das Kind rasch. Ich suchte den Kreisschulrat auf und verlangte eine sofortige Entfernung des Lehrers aus dem Schuldienst und seine Bestrafung. Der Schulrat versuchte mich

einzuschüchtern. Kinder machten sich gerne interessant, er kenne den guten Lehrer genau, er habe mit ihm studiert. Niemals könne dieser derartiges tun. Ich argumentierte zornig und drohte mit einem Schulstreik. Kaum war ich zu Hause, rief mich der Landrat aus Daun an, ich solle im Interesse der Partei nichts unternehmen. Er wolle sofort nach Trier zur Regierung und zum Provinzial-Schulrat fahren und dafür sorgen, dass der Lehrer sofort aus dem Schuldienst entlassen, und einer Bestrafung zugeführt werde. Er empfahl mir, meine drei Töchter bis zum Beginn der Herbstferien nicht mehr in die Schule zu schicken. In Daun war wohl etwas durchgesickert, denn eine Witwe kam weinend zu mir. Besagter Lehrer habe ihre Tochter auf den Holzspeicher geschickt. Dann sei er ihr nachgestiegen und habe sich über sie geworfen. Sie wollte ihn in der Schule zur Rede stellen, er verriegelte die Türe und beschimpfte sie schamlos. Er drohte ihr, sie ins Gerede zu bringen, daraufhin scheute sie sich, die Angelegenheit gerichtlich verfolgen zu lassen.
Nach den Herbstferien erfuhr ich, dass der alte Hauptlehrer nach wie vor in der Dauner Schule unterrichtete. Ich meldete mich telefonisch beim Landrat, der mir erklärte, er habe die Angelegenheit überprüft, der Lehrer habe sich nur väterlich um die Kinder gekümmert. Ich erklärte ihm, dass ich noch am gleichen Tage zum Regierungspräsidenten nach Trier fahren würde, der als Volljurist wohl wissen werde, was zu tun sei. Der Hauptlehrer gehöre gefesselt in Zuchthaus!
Kaum zu Hause, rief der Landrat mich an, er werde selbst nach Trier fahren und der Lehrer werde verschwinden. Und er verschwand, als "Hauptlehrer und Jugendführer" nach P. an der Mosel. Dort wurde er schon bald wegen ähnlicher Delikte verhaftet und kam ins Zuchthaus. Er wurde in ein militärisches Strafbataillon eingezogen, kam zur Front und kehrte nicht mehr zurück. Meine Mädels besuchten später die höhere Schule bei den Ursulinerinnen in Wittlich, die aber schon bald von den Nazis geschlossen wurde. Man empfahl mir, die Kinder auf eine nationalsozialistische höhere Schule zu schicken, was ich ablehnte. Ich plante, später Daun zu verlassen, um in einer Stadt mit höheren Schulen eine Praxis zu eröffnen. Mein Beschluss wurde bestärkt durch die ständigen Intrigen der Partei und auch durch Kollegen. Der Vorsitzende des NS Ärztebundes kam nach Daun, um die Ärzte des Ärztevereins PrümDaun in den NS-Ärztebund zu überführen. Man verlangte von mir den Austritt aus meiner katholischen Studentenverbindung, sonst sei eine Aufnahme nicht möglich. Er empfahl mir Schriften von Hoensbruch und Ähnliches. Ich lehnte schroff ab, ich sei alt genug, um mir meine Lektüre selbst auszusuchen, auch käme eine Mitgliedschaft im NS-Ärztebund für mich nie in Frage. Daraufhin durfte ich weder als Schularzt noch als Impfarzt tätig sein. Man entzog mir die Mütterberatung und die Betreuung der Bürgermeisterei in Dockweiler und Sarmersbach. Immerhin war ich dort fünfzehn Jahre als Arzt tätig. Ich wurde von der Betreuung der Hitlerjugend und des BDM (Bund deutscher Mädchen) ausgeschlossen, auch durfte ich die Frauenschaftsmitglieder nicht mehr untersuchen und behandeln. Selbst die Behandlung von Beamten und ihren Angehörigen entzog man mir. Der Zutritt zur Jugendherberge wurde mir verwehrt. Ich ließ meine Töchter in Daun durch eine private Hauslehrerin unterrichten. Zwischenzeitlich bemühte ich mich intensiv um eine Zulassung als Arzt in einer größeren Stadt. In Gerolstein traf ich den Vater meines Freundes Jupp Ververs, der in Kleve wohnte. Ich teilte ihm mit, dass ich ernstlich vorhatte, Daun zu verlassen. Herr Ververs machte mir den Vorschlag, mit ihm nach Kleve zu fahren. Ein jüdischer Arzt, Dr. Spier, würde wegen der Verfolgung der Menschen jüdischen Glaubens und der damit verbundenen Schikanen auswandern. Seine junge Frau hatte sich das Leben genommen. Schon am folgenden Tag fuhren wir nach Kleve, und ich sprach mit dem sympathischen und korrekten Kollegen Spier. Wir verstanden uns auf Anhieb gut und sprachen offen über die verheerende politische Situation. In kurzen Verhandlungen wurden wir uns bald einig, und ich kaufte dessen Haus und Praxis. Nun kamen weitere unvorhergesehene Schwierigkeiten auf mich zu, als ich mich als Arzt in Kleve niederlassen wollte. Der Vorsitzende des NS-Ärztebundes in Moers, Dr. G., machte meine Zulassungsbewilligung von einem Attest des Kreisleiters Kölle in Daun abhängig. Der solle meine politische Zuverlässigkeit bescheinigen. Ich war auf das Schlimmste gefasst! Denn mit Kölle hatte ich bereits eine Auseinandersetzung gehabt. (Bei seiner Amtsübernahme hatte er nämlich ein Flugblatt an alle Beamten, Angestellten und besser situierten Leute schicken lassen, mit dem Inhalt: "Ich fordere Sie hiermit auf, zur würdigen Ausstattung der Wohnung des Herrn Kreisleiters Kölle, eine erkleckliche Zahlung auf mein Konto zu leisten". Ich zahlte nichts und schickte ihm, empört über diese Zumutung, das Flugblatt unterzeichnet zurück, mit dem Zusatz: "Wem der Herr ein Amt gibt, dem gibt er auch die nötigen Mittel!") So bat ich meinen Freund und Bundesbruder, Stephan Reuland, Medizinalrat in Daun, um Unterstützung. Der sprach vorab mit dem Kreisleiter und verabredete einen Termin. Schon einen Tag später konnte ich bei ihm vorsprechen. Wir kamen sofort in ein fast freundschaftliches, politisches Gespräch. "Sie sind mir politisch ein Rätsel", argumentierte er. "Sie sind in keiner Parteiorganisation, Sie geben nichts bei Sammlungen etc. Warum arbeiten Sie nicht mit in der Parteiorganisation?" Ich antwortete ihm, es sei mir und vielen Leuten unmöglich mitzuarbeiten, weil in der Kreisverwaltung, unter seiner Leitung, mehrere unqualifizierte und undisziplinierte Leute arbeiten würden, darunter auch ein Zuchthäusler. Ich erwähnte das Parteimitglied, den Lehrer K. aus D., der das Gehalt des alten und unbeholfenen Ortspastors unterschlagen hatte, indem er den Stempel des Postbeamten entwendete und die Auszahlungen an den Pastor mit dem Amtsstempel versah und an sich überwies. Er musste, nach Klärung der Sachlage, zwei Jahre ins Zuchthaus. Auch sprach ich über den betrügerischen Bankrott eines Vorsitzenden von "Kraft durch Freude", ein höheres Parteimitglied und Beamter, der seine Frau schwer misshandelte, so dass ich sie mehrere Wochen behandeln musste. "Seien Sie beruhigt, keiner erfährt etwas von unserem Gespräch und ich werde für Abhilfe sorgen, darauf können Sie sich verlassen!", sagte der Kreisleiter zu mir. Nun musste ich ihm noch schonend mitteilen, dass ich Daun verlassen wollte und ein Attest von ihm benötigte, das meine politische Zuverlässigkeit bescheinigen sollte. Er nahm es zur Kenntnis und entgegnete: "Sie sollen zufrieden mit mir sein!"
Beim Vorzeigen dieses Attestes staunte Herr Dr. G. in Moers, und ich wurde als Arzt für den Bezirk Kleve zugelassen. Meine Kollegen beim Klever Ärztestammtisch begrüßten mich erst einmal zurückhaltend und skeptisch. Aufgrund des Dauner Attestes hielten sie mich für einen eingefleischten Nazi. Ein aufklärendes Gespräch mit mir wohlgesinnten Kollegen zerstreute aber bald alle Bedenken.
Im Januar 1937 zog ich mit meiner Familie von Daun um nach Kleve.